Denkschrift 2008
1 Vorbemerkung
Die Denkschrift stellt die wesentlichen Ergebnisse von Prüfungen des Rechnungshofs und der staatlichen Rechnungsprüfungsämter aus den Jahren 2007/2008 dar. Sie enthält damit die Informationen, die für die Entlastung der Landesregierung von Bedeutung sind. In ihr wird zwar eine Vielzahl von Einzelfeststellungen aufgezeigt, dennoch soll sie kein abschließender Bericht der Finanzkontrolle über ihre Tätigkeit für diesen Zeitraum sein. Aus diesen Einzeldarstellungen lassen sich auch keine allgemeinen Schlüsse zur Qualität der Landesverwaltung herleiten.
Im Berichtszeitraum hat der Rechnungshof zwei Beratende Äußerungen vorgelegt. Am 16.10.2007 wurde die Untersuchung über „Die einkommensteuerliche Bedeutung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung“ veröffentlicht (Landtagsdrucksache 14/1858). Sie zeigt auf, dass die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung insgesamt betrachtet über sehr lange Zeiträume hinweg keine Einkommensteuer generieren, sondern zu Ermäßigungen der Einkommensteuer führen. Mit dem Bericht „Die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg und ihre Beteiligungen an Bäder- und Kurunternehmen“ vom 08.11.2007 (Landtagsdrucksache 14/1945) forderte der Rechnungshof, die Landesbeteiligungen an den Staatsbädern aufzugeben, da der Betrieb von Heilbädern nicht zu den Aufgaben des Landes gehöre. Die finanzielle Unterstützung einzelner Heilbäder sei deshalb nicht gerechtfertigt und wirke wettbewerbsverzerrend. Beide Beratenden Äußerungen sind bereits abschließend im Landtag behandelt
2 Wesentliche Inhalte
Die Denkschrift 2008 zeigt ein breites Spektrum an Maßnahmen und Empfehlungen auf mit dem Ziel, zur Entlastung des Landeshaushaltes beizutragen. Bei Umsetzung der Vorschläge können insgesamt rund 55 Mio. € eingespart oder anderweitig eingesetzt werden.
Trotz steigender Steuereinnahmen bleibt die finanzielle Lage des Landes Baden-Württemberg äußerst angespannt. Die Verschuldung ist im Jahr 2007 um rund 580 Mio. € auf knapp 44,2 Mrd. € angestiegen (Nr. 3). Hätte die Landesregierung darauf verzichtet, überschüssige Liquidität vorzuhalten, wäre die Nettonullverschuldung bereits 2007 möglich gewesen. Der Aufwand für den Schuldendienst von 7,6 Mrd. € ist nach den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse (13,7 Mrd. €) sowie den Personalausgaben (12,8 Mrd. €) weiterhin der drittgrößte Posten im Landesetat. Angesichts dramatisch ansteigender Versorgungsausgaben muss das Land weitere strukturelle Einsparmaßnahmen ergreifen und Überschüsse zum Schuldenabbau verwenden. Um den Ausstieg aus der Verschuldung sicherzustellen, befürwortet der Rechnungshof weiterhin die Verankerung des Verschuldungsverbots in der Landesverfassung.
Zum sparsamen Umgang mit Landesmitteln gehören die optimale Nutzung vorhandener Ressourcen und die Wirtschaftlichkeit von Investitionen. Diese Leitgedanken einer verantwortlichen Haushaltspolitik ließ die ursprüngliche Planung für den Umbau und die Modernisierung der Universitätsbibliothek Freiburg vermissen. Die Verwaltung hat die Kritik und Anregungen der Finanzkontrolle aufgegriffen und den Wettbewerbsentwurf grundlegend überarbeitet. Dennoch könnten Baukosten in Höhe von rund 8 Mio. € eingespart werden, folgte man den Anregungen des Rechnungshofs vollständig (Nr. 20). Bei einem in der Krankenversorgung tätigen Unternehmen, das der Aufsicht des Landes unterliegt, hat die Prüfung gravierende Mängel in der Unternehmensführung aufgezeigt. Nach bisherigen Berechnungen des Rechnungshofs belaufen sich die finanziellen Nachteile aus der mangelhaften Arbeit weniger Bediensteter in leitender Funktion auf 1,2 Mio. € (Nr. 24). Dem Aufsichtrat blieben die Mängel verborgen, weil nur unzureichend kontrolliert wurde und wesentliche Steuerungsinstrumente fehlten. Einen ähnlich hohen Betrag könnte das Land sparen, wenn es mit den Ärzten und Krankenkassen eine Abrechnungspauschale für die Kosten von Schwangerschaftsabbrüchen vereinbaren würde (Nr. 17).
Zahlreiche Beiträge der Denkschrift befassen sich schwerpunktmäßig mit dem Zuwendungsbereich. Generell müssen Förderprogramme auf ihre Notwendigkeit und Wirksamkeit hin überprüft sowie Förderkriterien und -ziele klar formuliert werden. Der bürokratische Aufwand sollte bei solchen Programmen in einem vernünftigen Verhältnis zum Nutzen stehen. Das ist bei der Ausgleichszulage Landwirtschaft nicht der Fall. Sie gilt es stärker auf besonders benachteiligte Gebiete zu konzentrieren (Nr. 16). Durch eine Reduzierung der Fördertatbestände, bei gleichzeitiger Erhöhung der Mindestauszahlungsbeträge, würde das Land einen wesentlichen Beitrag zur Entbürokratisierung leisten und drohende Anlastungen der EU vermeiden. Angesichts eines Fördertopfes von fast 600 Mio. € für die ländlichen Gebiete muss sich das federführende Ministerium intensiv mit der Konzeption der Förderung auseinandersetzen (Nr. 15).
Sowohl bei der Förderung von kommunalen Tourismuseinrichtungen (Nr. 14) als auch beim „Investitionsprogramm Zukunft Bildung und Betreuung“ (Nr. 13) ist für die Finanzkontrolle eine schlüssige und zielgerichtete Konzeption nicht erkennbar. Bei den Tourismuseinrichtungen, insbesondere Heilbädern, sollten die Fördermittel schwerpunktmäßig nur dort eingesetzt werden, wo sie ertragfähige Investitionen auslösen. Bei der Förderung von Ganztagesschulen vergab das Land die Chance, Fördermittel des Bundes von weit mehr als einer halben Milliarde Euro bedarfsgerecht, zielgenau und wirtschaftlich einzusetzen. War das Programm wegen des gewählten „Windhundverfahrens“ schon 2005 kritisiert worden, setzen sich nun die Mängel in einer sehr fehleranfälligen Förderpraxis fort. Einen wirtschaftlicheren Einsatz der knappen Fördermittel mahnt der Rechnungshof auch bei Brückenausbauten im kommunalen Straßenbau an. Die Träger der Vorhaben neigen häufig dazu, überdimensioniert zu planen, anstatt sich am verkehrlichen Bedarf zu orientieren. Brücken werden oft soweit vernachlässigt und ungenügend instandgehalten, dass nur noch ein Neubau hilft. Dies darf nicht durch Förderung belohnt werden (Nr. 9). Nachdem es der Exportakademie Baden-Württemberg an der Hochschule Reutlingen in den letzen Jahren nicht gelungen ist, ohne Defizit auszukommen, schlägt der Rechnungshof ihre Übertragung auf Dritte oder die Schließung vor (Nr. 26).
Einsparpotenziale für den Landeshaushalt werden im Bereich der Heilfürsorge für Polizeibeamte gesehen. Bei einer 10-prozentigen Eigenbeteiligung der auf den jeweiligen Beamten entfallenden Heilfürsorgeaufwendungen - bis zu einer Obergrenze von 400 € im Jahr - könnte das Land 2 bis 3 Mio. € sparen (Nr. 8). Eine Untersuchung der bisherigen Praxis der W-Besoldung für Fachhochschulprofessoren zeigt (Nr. 25), dass das neue System mit leistungsbezogenen Gehaltsbestandsteilen funktionieren kann. Der Rechnungshof empfiehlt dem jetzt zuständigen Landesgesetzgeber, dieses System im Prinzip zu übernehmen, an einigen Punkten zu optimieren und den Übergang von alt zu neu zu beschleunigen. Zur Reduzierung der Personalkosten und zur Vermeidung unnötiger Risiken könnte auch beitragen, wenn die Hochschulen die einschlägigen Verwaltungsvorschriften strikter anwenden und die vorgesehenen Höchstsätze in der Besoldung von Gastprofessoren nur noch in Ausnahmefällen gewähren würden (Nr. 22). Personelle Ressourcen könnten besser genutzt werden, wenn das Land stärker darauf achten würde, dass Unterrichtsausfälle bei der Durchführung von Pädagogischen Tagen als Teil der Lehrerfortbildung konsequent vermieden werden (Nr. 11). Im Schulalltag ist dies nur ausnahmsweise der Fall.
Bei der Bewirtschaftung der landeseigenen Immobilien wären erhebliche Einsparpotenziale zu erschließen, wenn der Landesbetrieb Vermögen und Bau dem technischen Gebäudemanagement einen höheren Stellenwert einräumen würde (Nr. 21). In ihrer derzeitigen Form hält der Rechnungshof die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern nicht mehr für wirtschaftlich und empfiehlt dem Land, bei der Anpassung der Ausgabenerstattung zu berücksichtigen, dass Stadt- und Landkreise die Aufgabe auch gemeinsam wahrnehmen können (Nr. 10). Ein weiteres Einsparpotenzial hat die Finanzkontrolle bei der Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien aufgezeigt. Dazu müssten operative Aufgabenbereiche organisatorisch ausgegliedert und auf ein für alle Ministerien einheitliches Servicezentrum übertragen werden (Nr. 4).
Die Arbeitslage der Finanzämter bei der Prüfung von Kleinbetrieben hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert. Deshalb sind alle vom Rechnungshof aufgezeigten Möglichkeiten der Rationalisierung auszuschöpfen, auch sollte ein weiterer Personalabbau in der Amtsbetriebsprüfung vermieden werden. Anderenfalls drohen Steuerausfälle (Nr. 18). Eine höhere Kostendeckung könnte erreicht werden, wenn das Land die Kosten für tagesstrukturierende Angebote in seinen Heimsonderschulen bei den zuständigen Kostenträgern einfordern würde. Die Finanzkontrolle schätzt die jährlichen Einnahmeausfälle auf rund 7 Mio. € (Nr. 12). Weitere Einnahmen könnten erzielt werden, wenn die Leitstelle für Arzneimittelüberwachung den Gebührenrahmen ausschöpfen und kostendeckende Gebühren erheben würde (Nr. 7).
Erneut hat der Rechnungshof aufgezeigt, dass ein wirtschaftlicherer Einsatz der Datenverarbeitung in der Landesverwaltung möglich und geboten ist. So lässt die bereits 2005 auch vom Landtag geforderte Aufgabenbündelung beim Betrieb von Datennetzen weiter auf sich warten (Nr. 6). Optimierungsmöglichkeiten bietet auch der Zentralversand von Vordrucken für die Einkommensteuererklärung; sie sollten bedarfsgerecht an die Bürger geschickt werden. Zu klären wäre letztlich, ob zur besseren Akzeptanz der elektronischen Steuererklärung (ELSTER) auf den Versand der Vordrucksätze vollständig verzichtet werden sollte (Nr. 19). Fehler bei der Festsetzung der Versorgungsbezüge von Ruhestandsbeamten könnten unter anderem durch eine elektronische Versorgungsakte vermieden werden, die bereits anlässlich der Einstellung des Beamten angelegt wird (Nr. 5).
3 Neuerungen in der Denkschrift
Der Rechnungshof hat die Denkschrift erheblich gestrafft. Zur besseren Verständlichkeit sind die Beiträge in diesem Jahr kürzer gefasst und die Botschaften deutlicher herausgearbeitet. Die neue Form greift auch Anregungen aus dem Finanzausschuss auf.
Erstmals in seiner Geschichte wird der Rechnungshof im Herbst 2008 einen Ergebnisbericht auflegen. Mit diesem Bericht sollen künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus sämtliche parlamentarisch abschließend behandelten Prüfungen vorgestellt werden. Berichtet wird über die Zeit vom Januar 2006 bis Juni 2008. Die Denkschrift kann im Blick darauf ohne das bisher übliche Kapitel „Auswirkungen der Prüfungstätigkeit“ erscheinen.
4 Parlamentarische Beratung der Denkschrift 2007
Der Rechnungshof leitete die Denkschrift 2007 dem Landtag und der Landesregierung am 28.06.2007 zu (Landtagsdrucksache 14/1459). Der Finanzausschuss hat die Denkschrift in den Sitzungen am 20.09., 18.10. und 15.11.2007 beraten. Der Beschlussempfehlung des Finanzausschusses (Landtagsdrucksache 14/1994) hat der Landtag am 28.11.2007 unverändert zugestimmt. Nach diesem Beschluss wurde die Landesregierung gebeten, zu einzelnen Beiträgen der Denkschrift konkrete Maßnahmen zu treffen oder zu untersuchen und dem Landtag hierüber zu berichten (§ 114 Abs. 2 und 4 Landeshaushaltsordnung).
Der Rechnungshof wird künftig im Ergebnisbericht darstellen, wie die Landesregierung die Landtagsbeschlüsse umgesetzt hat. Die bisher in der Denkschrift als Anlage enthaltene Darstellung noch offener Landtagsbeschlüsse entfällt.
In der Sitzung vom 28.11.2007 hat der Landtag auch die in der Haushaltsrechnung 2005 nachgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben sowie die in der Übersicht 1 A dargestellten Abweichungen von den Stellenübersichten - unter Berücksichtigung etwaiger einschlägiger Feststellungen des Rechnungshofs - nachträglich genehmigt und der Landesregierung für 2005 Entlastung erteilt (Landtagsdrucksache 14/1996).
Schließlich ist der Landtag auch der Empfehlung des Finanzausschusses gefolgt, den Präsidenten des Rechnungshofs hinsichtlich der Rechnung des Rechnungshofs für das Haushaltsjahr 2005 nach § 101 Landeshaushaltsordnung zu entlasten (Landtagsdrucksache 14/1995).
Anhänge
Der Rechnungshof hat keine für die Entlastung der Landesregierung wesentlichen Abweichungen zwischen den in der Haushaltsrechnung 2006 und in den Büchern aufgeführten Beträgen festgestellt. Die geprüften Einnahmen und Ausgaben sind - von wenigen Einzelfällen abgesehen - ordnungsgemäß belegt.
1 Vorlage und Gestaltung der Haushaltsrechnung des Landes
Gemäß Art. 83 Abs. 1 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg und § 114 Abs. 1 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung für Baden-Württemberg (LHO) legte der Finanzminister dem Landtag mit Schreiben vom 07.12.2007 die Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2006 als Grundlage für die Entlastung der Landesregierung vor (Landtagsdrucksache 14/1216).
Die Haushaltsrechnung ist entsprechend den Vorschriften der §§ 81 bis 85 LHO gestaltet. Sie enthält alle in § 81 Abs. 1 und 2 LHO vorgeschriebenen Angaben für den Nachweis der bestimmungsgemäßen Ausführung des Staatshaushaltsplans. Die finanziellen Ergebnisse der Rechnungslegung sind in
- einem kassenmäßigen Abschluss gemäß § 82 LHO (Ist-Ergebnisse ohne Haushaltsreste),
- einem Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO (Ist-Ergebnisse zuzüglich Haushaltsreste) und
- einer Gesamtrechnung (Soll-Ist-Vergleich der Einzelpläne)
dargestellt.
Der kassenmäßige Abschluss, der Haushaltsabschluss und die Gesamtrechnung sind entsprechend § 84 LHO auf S. 15 bis 20 der Haushaltsrechnung erläutert. Die in § 85 Abs. 1 LHO genannten Übersichten sind beigefügt (S. 857 bis 873 und S. 879 bis 880); weitere Erläuterungen über den Haushaltsvollzug enthalten die besonderen Übersichten auf den S. 41 bis 83.
2 Ergebnisse der Haushaltsrechnung
Der kassenmäßige Abschluss und der Haushaltsabschluss der Haushaltsrechnung 2006 sind in der Tabelle 1 zusammengefasst und dem Vorjahr gegenübergestellt.

Ein Teilbetrag in Höhe von 178.981.900 € des kassenmäßigen Überschusses im Haushaltsjahr 2006 in Höhe von 535.246.097,48 € wurde im Haushaltsjahr 2007 bei Kapitel 1212 Titel 361 02 als außerplanmäßige Einnahme gebucht. Der restliche Betrag von 356.264.197,48 € war am 31.12.2007 im Verwahrungsbuch der Landesoberkasse nachgewiesen.
3 Feststellungen des Rechnungshofs nach § 97 Abs. 2 Nr. 1 und 2 Landeshaushaltsordnung
Der Rechnungshof prüfte die Ordnungsmäßigkeit der Haushaltsrechnung des Landes für das Haushaltsjahr 2006 mit Unterstützung des Staatlichen Rechnungsprüfungsamts Stuttgart. Die in der Haushaltsrechnung aufgeführten Beträge der Einnahmen und Ausgaben stimmen mit den in den Rechnungslegungsbüchern nachgewiesenen Beträgen überein. In den geprüften Rechnungen wurden keine Einnahmen oder Ausgaben festgestellt, die nicht belegt waren; etwaige Ordnungsverstöße wurden mit den betroffenen Ressorts erörtert.
Über die verfassungsrechtlich unzulässige Einwilligung des Finanzministeriums in eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von bis zu 58 Mio. € berichtete der Rechnungshof bereits in der Denkschrift 2007.
4 Druck- und Darstellungsfehler
Bei der Gesamtrechnungsprüfung stellte der Rechnungshof keine wesentlichen Druck- und Darstellungsfehler in der Haushaltsrechnung des Landes fest.
5 Haushaltsüberschreitungen
Über- und außerplanmäßige Ausgaben bedürfen der vorherigen Zustimmung des Finanzministeriums, die nur im Falle eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses erteilt werden darf. Die überplanmäßigen Ausgaben einschließlich der Vorgriffe sowie die außerplanmäßigen Ausgaben sind in der Haushaltsrechnung einzeln nachgewiesen und in der Übersicht 1 zur Haushaltsrechnung (S. 859 bis 873) zusammengestellt und begründet. Sie betragen insgesamt rd. 63 Mio. €. Hiervon waren rd. 50 Mio. € Sachausgaben und rd. 13 Mio. € Personalausgaben.
Mehrausgaben in größerem Umfang sind für folgende Zwecke angefallen:
- 4,2 Mio. € für zusätzlichen Personalaufwand wegen der Agrarreform im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (Kapitel 0809 Titel 427 51),
- 11,1 Mio. € für höhere Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände wegen der Änderungen beim Wohngeld für Arbeitslosengeld II-Empfänger (Kapitel 0917 Titel 633 03),
- 7,0 Mio. € für höhere Unterhaltsvorschüsse und -ausfallleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz aufgrund gestiegener Antragszahlen (Kapitel 0919 Titel 681 01),
- 2,5 Mio. € für höhere Krankenfürsorgeleistungen an Bedienstete im Erziehungsurlaub, in Elternzeit und dergleichen wegen Kostensteigerungen im Gesundheitswesen und aufgrund der höheren Zahl von Anspruchsberechtigten (Kapitel 1212 Titel 681 02),
- 3,6 Mio. € für einen höheren Zuschuss an die Max-Planck-Gesellschaft wegen einer Nachzahlung für das Jahr 2003 und der Steigerung des Königsteiner Schlüssels im Jahr 2006 (Kapitel 1499 Titel 685 01).
Mit Schreiben vom 20.06.2007 teilte das Finanzministerium dem Landtag gemäß § 7 Abs. 4 Staatshaushaltsgesetz 2005/06 die über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Haushaltsjahres 2006 von mehr als 100.000 € im Einzelfall mit. Die Mitteilung (Landtagsdrucksache 14/1414) wurde vom Finanzausschuss des Landtags in der 17. Sitzung am 12.07.2007 zur Kenntnis genommen.
Nach dem Ergebnis der Rechnungsprüfung lag im Haushaltsjahr 2006 bei den über- und außerplanmäßigen Ausgaben von 500 € und mehr in 43 Fällen die Einwilligung des Finanzministeriums nicht vor. Die Summe dieser Haushaltsüberschreitungen beträgt 2,1 Mio. € (Vorjahr: 9,8 Mio. €). Davon entfallen auf Personalausgaben 511.000 € (Vorjahr: 507.000 €).
Die vom Finanzministerium bewilligten Abweichungen von den Stellenübersichten sind in der Übersicht 1 A zur Haushaltsrechnung (S. 875 bis 878), dargestellt und begründet.
Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben bedürfen nach Art. 81 Satz 3 der Verfassung des Landes Baden-Württemberg der Genehmigung des Landtags. Diese wurde, zugleich für die Abweichungen von den Stellenübersichten, vom Finanzministerium im Zusammenhang mit der Vorlage der Haushaltsrechnung (siehe Pkt. 1) beantragt.
6 Buchungen an unrichtiger Stelle
In der Übersicht 1 zur Haushaltsrechnung (über- und außerplanmäßige Ausgaben einschließlich der Vorgriffe) sind auch Fälle von Buchungen an unrichtiger Haushaltsstelle - sogenannte Titelverwechslungen - enthalten, die auf Versehen der Verwaltung beruhen (Verstöße gegen § 35 Abs. 1 LHO). Sie haben eine relativ geringe Bedeutung für das Gesamtbild des Landeshaushalts.
Die Titelverwechslungen von mehr als 1.000 € sind - soweit diese die über- oder außerplanmäßigen Ausgaben verändern - in der Tabelle 2 dargestellt.
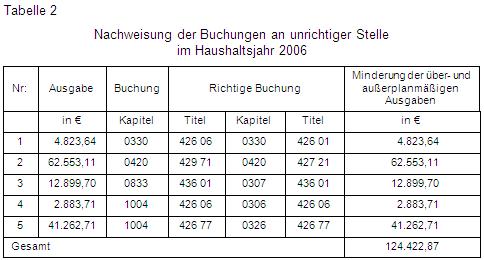
Bei richtiger Buchung wären die in der Haushaltsrechnung nachgewiesenen über- und außerplanmäßigen Ausgaben um 124.422,87 € niedriger gewesen.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Der Haushalt des Landes wurde im Haushaltsjahr 2006 nach den Vorgaben des Staatshaushaltsplans vollzogen.
1 Haushalts-Soll und Haushalts-Ist 2006
Der Haushaltsrechnung des Landes für das Haushaltsjahr 2006 liegen die Gesetze über die Feststellung des Staatshaushaltsplans von Baden-Württemberg für die Haushaltsjahre 2005 und 2006 (Staatshaushaltsgesetz 2005/06) vom 01.03.2005 (Gesetzblatt für Baden-Württemberg 2005, S. 147) und über die Feststellung eines Nachtrags zum Staatshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 vom 08.12.2005 (Gesetzblatt für Baden-Württemberg 2005, S. 697) zugrunde. Danach wurde der Staatshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 in Einnahme und Ausgabe auf 31.771.355.000 € festgestellt.
Das rechnungsmäßige Jahresergebnis 2006 (Haushalts-Ist einschließlich Haushaltsreste 2006) weist gegenüber dem Haushalts-Soll (Haushaltsansätze einschließlich Haushaltsreste aus dem Vorjahr) einen Überschuss in Höhe von 956.162.430,27 € aus (siehe Beitrag Nr. 1, Tabelle 1), der sich aus dem Saldo der Mehreinnahmen von 2.314.673.094,13 € und der Mehrausgaben von 1.358.510.663,86 € ergibt.
Wie sich die Mehreinnahmen und die Mehrausgaben aus den Teilergebnissen der Einzelpläne errechnen, ist in der Landeshaushaltsrechnung 2006 (Anlage 1 zur Gesamtrechnung, S. 36/37, Spalte 9) sowie in den Erläuterungen hierzu (S. 41 bis 48) dargestellt.
2 Jahresvergleich - einschließlich Vorschau auf das Haushaltsjahr 2007
Die Tabellen 1 und 2 zeigen die Entwicklung der Ausgabe-Ansätze und Ist-Ausgaben insgesamt sowie der Ist-Ausgaben je Einzelplan. Zur Tabelle 1 wird darauf hingewiesen, dass die Drittmittel der Universitäten seit dem Jahr 2000 nicht mehr im Soll veranschlagt sind.
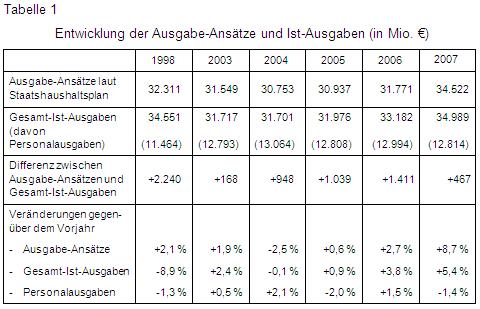
Von 1998 bis 2007 stiegen die Gesamt-Ist-Ausgaben um 1,3 % und die Personalausgaben um 11,8 %. Der geringe Anstieg der Gesamt-Ist-Ausgaben ist darauf zurück zu führen, dass die Kreditaufnahme ab dem Staatshaushaltsplan 2000/01 nicht mehr brutto, sondern netto, also ohne die Tilgungsausgaben, veranschlagt ist.
Die Reduzierung der Personalausgaben in den Jahren 2005, 2006 und 2007 gegenüber dem Haushaltsjahr 2004 ist auf die Kommunalisierung von Personal im Zuge der Verwaltungsstrukturreform zurück zu führen.
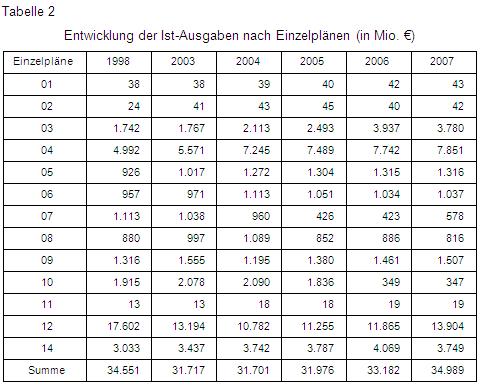
Seit dem Haushaltsjahr 2004 sind die Ausgaben für die Versorgungsbezüge der Beamten und Richter sowie ihrer Hinterbliebenen - bis auf Restbereiche - in den Einzelplänen der jeweiligen Ressorts nachgewiesen. Dies gilt ebenso für die Beihilfen der Versorgungsempfänger. Bis 2003 waren diese Ausgaben im Einzelplan 12 veranschlagt.
3 Globale Minderausgaben
Im Staatshaushaltsplan 2005/06 waren für das Haushaltsjahr 2006 bei Kapitel 1212 Titel 972 01 globale Minderausgaben in Höhe von 213,1 Mio. € veranschlagt; sie verteilen sich auf die Einzelpläne, wie in der Tabelle 3 dargestellt.
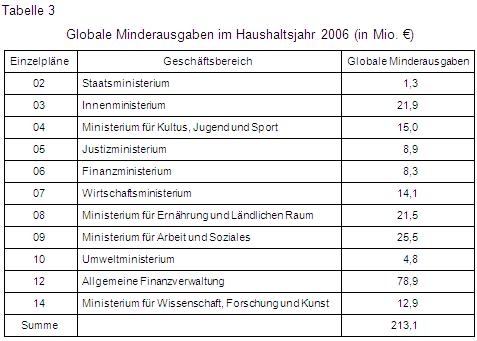
Die Einsparungen bei den Sachausgaben - Haushaltsgruppen 5 bis 8 - wurden von den Ressorts nachgewiesen.
4 Haushaltsreste und Vorgriffe
4.1 Haushaltsjahr 2006
Beim Abschluss der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2006 wurden folgende Reste in das Haushaltsjahr 2007 übertragen:
Einnahmereste 1.702.842.611,61 €
Ausgabereste 1.025.083.346,97 €
Mehrbetrag Einnahmereste 677.759.264,64 €
Die Einnahmereste umfassen fast ausschließlich noch nicht verbrauchte Kreditermächtigungen in Höhe von 56,6 Mio. € für das Projekt Neue Steuerungsinstrumente (Kapitel 1230 Titel 261 01) und in Höhe von 1.645,6 Mio. € für Kreditmarktmittel (Kapitel 1206 Titel 325 86). Wie sich die Ausgabereste zusammensetzen, ist auf den S. 49 bis 52 der Haushaltsrechnung dargestellt.
Mit Schreiben vom 11.09.2007 hat das Finanzministerium gemäß § 7 Abs. 5 Staatshaushaltsgesetz 2006/06 dem Finanzausschuss des Landtags die in das Haushaltsjahr 2007 übertragenen Ausgabereste mitgeteilt. Der Finanzausschuss hat hiervon in seiner 20. Sitzung am 15.11.2007 Kenntnis genommen.
Wie in den Vorjahren war die Landesregierung nach § 9 Abs. 2 Staatshaushaltsgesetz 2005/06 ermächtigt, unverbrauchte Mittel aus übertragbaren Bewilligungen (Ausgabereste) in Abgang zu stellen; sie hat diese Ermächtigung im Umfang von rd. 52 Mio. € ausgeschöpft.
4.2 Jahresvergleich
Die Tabellen 4 und 5 zeigen, wie sich die Haushaltsreste in den letzten Jahren entwickelt haben. Bei den Einnahmeresten handelt es sich im Wesentlichen um noch nicht verbrauchte Kreditermächtigungen.
Die Höhe der Haushaltsreste 2007 stand bei Abschluss der Denkschriftberatungen des Rechnungshofs noch nicht fest.
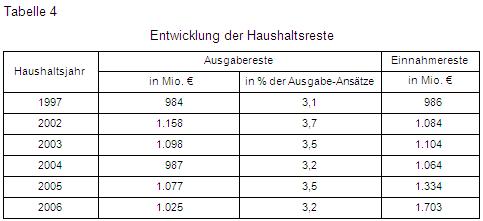
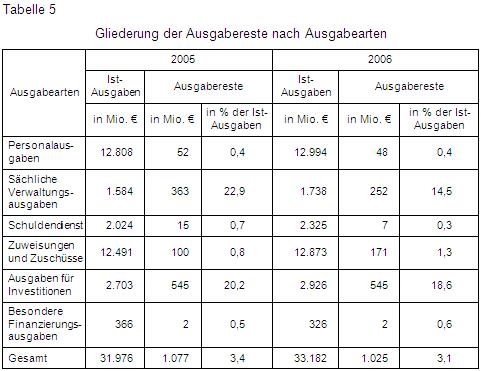
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Die Schulden des Landes, einschließlich der verlagerten Verpflichtungen, sind zum Ende des Jahres 2007 auf 44,2 Mrd. € angewachsen. Die haushaltsmäßige Nettokreditaufnahme belief sich im Haushaltsjahr 2007 auf 1 Mrd. €. Hätte die Landesregierung darauf verzichtet, überschüssige Liquidität vorzuhalten, wäre die Nettonullverschuldung bereits 2007 möglich gewesen.
1 Verschuldungslage
1.1 Schuldenzuwachs
Die Verschuldung des Landes ist auch im Haushaltsjahr 2007 angestiegen. Die Landesschulden und die auf Dritte verlagerten Verpflichtungen haben sich gegenüber dem Vorjahr, wie in Tabelle 1 dargestellt, verändert.

Danach sind die Schulden, einschließlich der verlagerten Verpflichtungen, im Haushaltsjahr 2007 um insgesamt 579,7 Mio. € gestiegen.
Im Jahr 2007 nahm das Land aufgrund der Ermächtigung im Staatshaushaltsgesetz Kassenverstärkungskredite an 9 Tagen (Vorjahr 26 Tage) in Anspruch; mit 45,5 Mio. € war am 15.01.2007 der höchste Stand der Kassenkredite zu verzeichnen. Am 31.12.2007 waren keine Kassenkredite aufgenommen.
Die Entwicklung der Landesschulden und der verlagerten Verpflichtungen in den letzten zwanzig Jahren zeigt Abbildung 1.
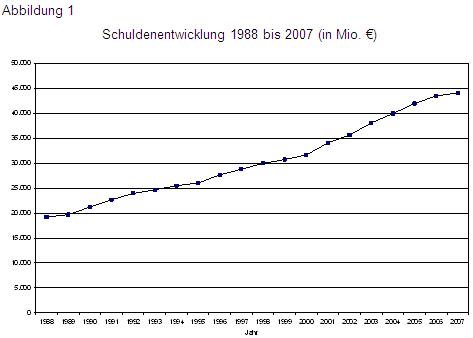
1.2 Haushaltsmäßige Kreditaufnahme
Im Haushaltsjahr 2007 wurden am Kapitalmarkt 6.487,0 Mio. € neue Darlehen aufgenommen. Gleichzeitig wurden 5.489,6 Mio. € getilgt. Die haushaltsmäßige Nettokreditaufnahme belief sich somit 2007 auf 997,4 Mio. € und war um 538,1 Mio. € geringer als im Vorjahr (1.535,5 Mio. €). Zum Ende des Haushaltsjahres 2007 waren nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen früherer Haushaltsjahre in Form von Einnahmeresten in Höhe von 1.646,4 Mio. € vorhanden. Da das Haushaltsjahr 2007 mit einem kassenmäßigen Überschuss in Höhe von 715,3 Mio. € abgeschlossen hat und der restliche kassenmäßige Überschuss des Haushaltsjahres 2006 in Höhe von 356,3 Mio. € haushaltsmäßig noch nicht vereinnahmt ist (siehe Beitrag Nr. 1), lag im Haushaltsjahr 2007 eigentlich kein Kreditbedarf vor. Vielmehr wäre bereits in dieser Haushaltsperiode eine Nettonullverschuldung möglich gewesen. Durch „überschüssige“ Liquidität wurden im Haushaltsjahr 2007 Zinsen aus Geldanlagen in Höhe von rd. 88 Mio. € erwirtschaftet.
Der gegenüber der Nettokreditaufnahme von 997,4 Mio. € um 359,0 Mio. € geringere Zuwachs der Kreditmarktschulden zum 31.12.2007 (638,4 Mio. €) ist darauf zurückzuführen, dass einerseits im Haushaltsjahr 2007 gebuchte Kredite in Höhe von 385,0 Mio. € bereits im Haushaltsjahr 2006 valutiert waren und andererseits 26,0 Mio. € der im Jahre 2007 valutierten Kredite erst im Jahr 2008 haushaltsmäßig nachgewiesen werden.
Der Anteil der Nettokreditaufnahme von 997,4 Mio. € an den bereinigten Gesamtausgaben in Höhe von 32.860,8 Mio. € (Kreditfinanzierungsquote) hat sich gegenüber dem Vorjahr von 4,7 % auf 3,0 % reduziert.
1.3 Kreditaufnahme und Schuldendienst
Die Entwicklung der jährlichen (haushaltsmäßigen) Brutto- und Nettokreditaufnahme sowie der Aufwendungen für den Schuldendienst in den letzten zehn Jahren zeigt Tabelle 2.
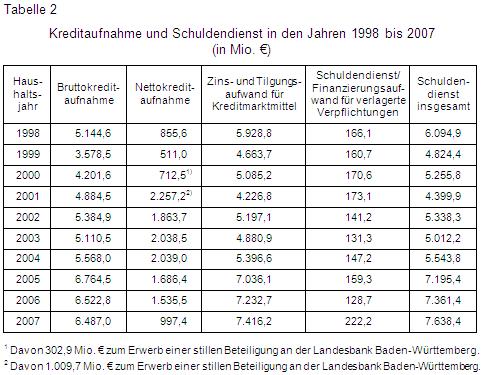
Die Ist-Ausgaben des Schuldendienstes für die Kreditmarktmittel (Zinsen und Tilgungsleistungen bei Kapitel 1206, Ausgabe-Titelgruppe 86 - ohne Titel 563 86 Ausgleichsstock - und bei Kapitel 1230 Titel 571 01) sind im Haushaltsjahr 2007 gegenüber dem Vorjahr um 183,5 Mio. € gestiegen. Dies ist auf höhere Tilgungsaufwendungen gegenüber dem Haushaltsjahr 2006 zurückzuführen.
Die Schuldendienstausgaben an die Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank (L-Bank) und die Erstattung des Finanzierungsaufwands an die Finanzierungsgesellschaft für öffentliche Vorhaben des Landes Baden-Württemberg mbH sowie an die LBBW Immobilien Projektmanagement GmbH beliefen sich im Haushaltsjahr 2007 auf 222,2 Mio. €. Darin sind auch die Ersatzleistungen an die L-Bank für die Finanzierung des Darlehensanteils des Landes bei der Ausbildungsförderung für Studierende in Höhe von 25,6 Mio. € enthalten, die aus systematischen Gründen dem gesamten Schuldendienst zuzurechnen sind.
Die Ausgaben des Schuldendienstes für die Kreditmarktmittel und der Aufwand für die verlagerten Verpflichtungen beliefen sich im Haushaltsjahr 2007 auf 7.638,4 Mio. €. Dementsprechend beträgt der Anteil des gesamten Schuldendienstes an den Gesamtausgaben (einschließlich der haushaltsmäßig nicht ausgewiesenen Tilgungsausgaben in Höhe von 5.489,6 Mio. €) des Landes 18,9 % (Vorjahr 19,3 %).
Der Aufwand für den Schuldendienst entsprach somit rund einem Fünftel der Gesamtausgaben und war nach den Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse sowie den Personalausgaben der drittgrößte Posten im Landesetat.
1.4 Pro-Kopf-Verschuldung
Die Verschuldung des Landes am Kreditmarkt erhöhte sich zum 31.12.2007 auf 41.709,9 Mio. €. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug danach 3.881 € und ist gegenüber dem Vorjahr um 1,5 % gestiegen; in allen Flächenländern belief sie sich durchschnittlich - bei einer Steigerung um 1,1 % - auf 5.091 € (Vorjahr 5.038 €). Zur Pro-Kopf-Verschuldung im Einzelnen siehe Tabelle 3.

Wie bisher liegt Baden-Württemberg auf dem drittbesten Platz aller Flächenländer und auf dem zweitbesten Platz der acht alten Flächenländer. Gemessen an der Veränderung gegenüber dem Vorjahr nimmt Baden-Württemberg nur einen Mittelplatz ein.
2 Verfassungsrechtliche Kreditfinanzierungsgrenze
Nach Art. 84 der Landesverfassung dürfen die Einnahmen aus Krediten die Summe der im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben für Investitionen grundsätzlich (bei wirtschaftlicher Normallage) nicht überschreiten.
Entsprechend der Begründung zu Art. 84 der Landesverfassung umfasst das Investitionsvolumen die nach der Haushaltssystematik im Haushaltsplan unter den Hauptgruppen 7 und 8 des Gruppierungsplans veranschlagten Ausgaben. Die Gesetzesbegründung zu § 10 des für Bund und Länder maßgeblichen Haushaltsgrundsätzegesetzes definiert die Investitionsausgaben als eigenfinanzierte Investitionen und verlangt, von Dritten gewährte Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge zu Investitionen (Obergruppen 33 und 34) bei der Ermittlung der Summe der Ausgaben für Investitionen abzuziehen.
Die in diesem Sinne eigenfinanzierten Investitionen beliefen sich im Haushaltsjahr 2007 auf 2.013,9 Mio. €. Nach dieser Auslegung des Investitionsbegriffs hat das Land mit der Nettokreditaufnahme von 997,4 Mio. € die verfassungsmäßige Verschuldungsgrenze eingehalten.
Der Rechnungshof hält allerdings eine engere Auslegung des Investitionsbegriffs für sachgerecht (siehe Denkschrift 2006, Beitrag Nr. 3, Landesschulden). Danach sollten insbesondere die Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter nicht in das Investitionsvolumen des Landes einbezogen werden.
Auf dieser Basis ergibt sich das in Tabelle 4 dargestellte Bild.
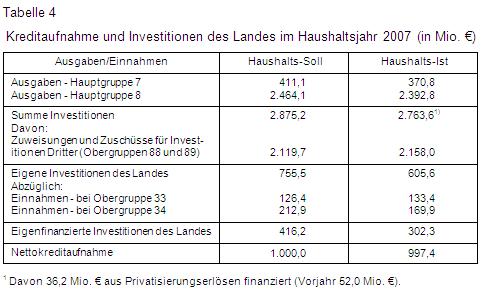
Bei Zugrundelegung des vom Rechnungshof geforderten engeren Investitionsbegriffs stehen der Nettokreditaufnahme im Haushaltsjahr 2007 in Höhe von 997,4 Mio. € eigenfinanzierte Investitionen des Landes in Höhe von nur 302,3 Mio. € gegenüber. Dabei sind die kalkulatorischen Abschreibungen an hergestellten oder beschafften Investitionsgütern noch nicht berücksichtigt.
3 Kreditaufnahme, Zinsausgaben und Steueraufkommen
Das Steueraufkommen des Landes belief sich im Haushaltsjahr 2007 auf 26.941 Mio. € und ist gegenüber dem Vorjahr um 2.935 Mio. € (+12,2 %) gestiegen. Unter Berücksichtigung der Mehrausgaben im kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 99 Mio. € ergaben sich gegenüber dem Haushaltsansatz Nettosteuermehreinnahmen in Höhe von 168 Mio. €. Durch die beträchtliche Erhöhung hat sich die Steuerdeckungsquote, d. h. das Verhältnis der Steuereinnahmen zu den bereinigten Gesamtausgaben, im Haushaltsjahr 2007 von 82,0 % gegenüber dem Vorjahr (73,1 %) deutlich verbessert.
Für die bestehenden Kreditmarktschulden sind im Haushaltsjahr 2007 Zinsausgaben in Höhe von 1.927 Mio. € (Vorjahr 2.245 Mio. €) angefallen. Danach musste ein Anteil von 7,2 % des Steueraufkommens (Vorjahr 9,4 %) zur Deckung der Zinsverpflichtungen verwendet werden.
Die Reduzierung der Zinsausgaben gegenüber dem Vorjahr um 318 Mio. € (-14,2 %) ist darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2006 außerordentliche Zinszahlungen (322,6 Mio. €) für ein im Jahre 1986 aufgenommenes sogenanntes Zero-Darlehen angefallen waren. Die deutliche Verbesserung der Zins-Steuer-Quote ist neben dem geschilderten Sondereffekt von 2006 auf das niedrige Zinsniveau zurückzuführen.
4 Ausgabenstruktur
Im Haushaltsjahr 2007 beliefen sich die bereinigten Gesamtausgaben auf 32.861 Mio. €. Davon entfielen 13.727 Mio. € (41,8 %) auf Zuweisungen und Zuschüsse einschließlich der Finanzausgleichsleistungen an Länder und Gemeinden. Der Anteil der Personalausgaben in Höhe von 12.814 Mio. € beträgt 39 %. Bei einem Investitionsvolumen von 2.764 Mio. € ergibt sich eine Investitionsquote von 8,4 %. Die Zinsausgaben beliefen sich auf 1.927 Mio. €, dies entspricht einer Zinsausgabenquote von 5,9 %. Der Anteil der sächlichen Verwaltungsausgaben in Höhe von 1.577 Mio. € beläuft sich auf 4,8 %.
Die Entwicklung der prozentualen Anteile der wesentlichen Ausgabearten an den bereinigten Gesamtausgaben in den letzten zehn Jahren zeigt Abbildung 2.
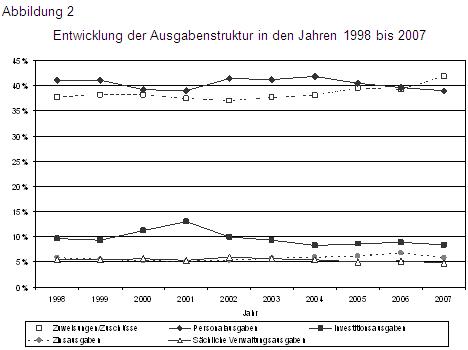
5 Beurteilung und Fazit
Die Haushaltslage des Landes hat sich im Haushaltsjahr 2007 aufgrund der beträchtlichen Erhöhung des Steueraufkommens wesentlich verbessert. Entsprechend der Mittelfristigen Finanzplanung ist die Neuverschuldung im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2008 auf Null zurückgeführt worden.
Dies wäre bereits im Haushaltsjahr 2007 möglich gewesen. Zum einen hat das Haushaltsjahr 2007 mit einem kassenmäßigen Überschuss in Höhe von rd. 715 Mio. € abgeschlossen. Zum anderen wurden von dem kassenmäßigen Überschuss des Haushaltsjahres 2006 in Höhe von rd. 535 Mio. € lediglich rd. 179 Mio. € haushaltsmäßig 2007 nachgewiesen. Nach Auffassung des Rechnungshofs hätte der Haushaltsüberschuss 2006 in voller Höhe gemäß § 25 Abs. 2 Landeshaushaltsordnung im Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2007 eingestellt werden können. Somit hätte es im Haushaltsjahr 2007 keiner Nettokreditaufnahme bedurft.
Nach der Neufassung des § 18 Landeshaushaltsordnung ist der Haushaltsplan ab 01.01.2008 grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten auszugleichen. Außerdem soll die Gesamtverschuldung am Kreditmarkt den am 31.12.2007 erreichten Betrag (41.710 Mio. €) nicht dauerhaft überschreiten.
Der Rechnungshof hält trotz der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen nachhaltig wirkende strukturelle Einsparmaßnahmen zur dauerhaften Sicherstellung ausgeglichener Haushalte oder zur Erzielung von Überschüssen zum Schuldenabbau für dringend geboten. Dies gilt insbesondere angesichts dramatisch ansteigender Versorgungsausgaben. Ein Sanierungskonzept, das faktisch Kreditaufnahmen durch Steuererhöhungen und -mehreinnahmen substituiert, wird nicht auf Dauer tragen. Um den Ausstieg aus der Verschuldung sicherzustellen, befürwortet der Rechnungshof weiterhin die Verankerung des Verschuldungsverbots in der Landesverfassung.
6 Landesschuldbuch
Das Landesschuldbuch erbringt den ordnungsgemäßen Nachweis über die Buchschulden des Landes. Der Rechnungshof hat die im Haushaltsjahr 2007 in das Landesschuldbuch eingetragenen Schuldbuchforderungen geprüft. Die Prüfung hat keine Beanstandungen ergeben.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Die Koordination und Steuerung der Öffentlichkeitsarbeit in den Ministerien kann verbessert und kostengünstiger gestaltet werden. Der Rechnungshof schlägt eine zentrale Servicestelle vor, welche für die Ministerien unter Wahrung der Ressorthoheit die operativen Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit erledigt.
1 Allgemeines
Die typischen Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien sind Publikationen wie Broschüren, Flyer, Anzeigen und Internetauftritte sowie Veranstaltungen wie Kongresse, Preisverleihungen und Beteiligungen an Messen. Ein wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit ist die Pressearbeit. Deren Ziel ist es, die Tätigkeiten, Themenbereiche und Leistungen des jeweiligen Ressorts gegenüber den Medien darzustellen und zu vermitteln.
Der Rechnungshof hat gemeinsam mit den Ministerien eine Abgrenzung zwischen der Pressearbeit und der Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen und im Zuge dieser Untersuchung allein die Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien im engeren Sinne, also ohne Pressearbeit, untersucht.
Die Ziele der Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien wurden wie folgt definiert:
- Vertiefte Informationen über den Fachbereich vermitteln,
- Detailinformationen weiter geben,
- Beratung der Bevölkerung,
- Vermittlung langfristiger Zielsetzungen,
- Informationen als Entscheidungshilfen für Zielgruppen geben,
- Nachfrage wecken und
- sachlich fundiertes Vertrauen und Sympathie wecken und fördern.
2 Personaleinsatz und Kosten der Öffentlichkeitsarbeit
Der Rechnungshof hat gemeinsam mit den Ministerien die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit definiert und in einem Aufgabenkatalog zusammengefasst. Dieser war Grundlage für die Mitarbeiterbefragung.
In den Landesministerien wurden im Jahr 2005 insgesamt 67 Vollzeitstellen für Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Dies entspricht Personalkosten in Höhe von rd. 6 Mio. €/Jahr. Bezogen auf die Personalausstattung der Ministerien insgesamt entspricht dies einem Anteil von 2 %.
Die Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit betrugen 8,7 Mio. €. Hiervon entfielen rd. 50 % (4,3 Mio. €) auf die Werbe- und Sympathiekampagne des Landes (WSK).
Im Jahr 2005 führte die Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien somit zu Gesamtkosten in Höhe von 14,7 Mio. €.
Die Verteilung der Personal- und Sachkosten für die Öffentlichkeitsarbeit auf die einzelnen Ministerien zeigt Tabelle 1.

Die rd. 67 Vollzeitäquivalente (VZÄ) verteilen sich auf insgesamt 306 Mitarbeiter. Die Bandbreite der in den Ministerien eingesetzten Personalkapazitäten für die Öffentlichkeitsarbeit liegt zwischen 1,7 VZÄ im Finanzministerium und 28,1 VZÄ im Wirtschaftsministerium. Diese große Bandbreite ist insbesondere auf die unterschiedlichen Aufgabenstellungen der Ministerien zurückzuführen. Beim Wirtschaftsministerium schlägt zudem das Haus der Wirtschaft als Dienstleistungszentrum für die mittelständische Wirtschaft und Austragungsort einer Vielzahl von Veranstaltungen mit zu Buche.
Die insgesamt für die Öffentlichkeitsarbeit eingesetzten Personalkapazitäten verteilen sich auf die einzelnen Aufgaben entsprechend Tabelle 2.

Tabelle 2 verdeutlicht, dass insgesamt die Durchführung von Veranstaltungen mit 12,9 VZÄ (entspricht 19 % aller VZÄ) die meisten Personalressourcen in Anspruch nimmt. Danach folgen die Steuerungs- und Unterstützungsleistungen mit 9,4 VZÄ (14 %), die Konzeption und Erstellung von Beiträgen mit 6,3 VZÄ (9 %) und der Internetauftritt mit 5,5 VZÄ (8 %).
3 Aufbau- und Ablauforganisation, Aufgabenwahrnehmung
3.1 Organisation der Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit wird in den Ministerien unterschiedlich gesteuert. Der Anteil der Organisationseinheit Presse-/Öffentlichkeitsarbeit (PÖ) an der Öffentlichkeitsarbeit liegt zwischen 11 % beim Wirtschaftsministerium und 88 % beim Ministerium für Arbeit und Soziales. Diese Zahlen spiegeln die unterschiedlichen Organisationsformen der Ministerien beispielhaft wider. Während im Wirtschaftsministerium die Öffentlichkeitsarbeit überwiegend dezentral von den Fachabteilungen wahrgenommen wird, werden im Ministerium für Arbeit und Soziales und Staatsministerium die Aufgaben nahezu ausschließlich, im Innenministerium, Justizministerium, Umweltministerium und im Wissenschaftsministerium überwiegend zentral erledigt.
In den übrigen Ressorts ist die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit vorwiegend dezentral organisiert.
Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Schnittmengen zwischen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit eher gering sind und eine fachliche und organisatorische Trennung dieser beiden Aufgaben möglich ist.
Beim Umweltministerium und Ministerium für Arbeit und Soziales wurden Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit bereits organisatorisch getrennt. Die Öffentlichkeitsarbeit wird in diesen Ministerien weitgehend von der Zentralstelle Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit (Z/KÖ) geleistet. Sie koordiniert und steuert den Aufgabenbereich Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der Leistungen der Fachabteilungen.
Diese Form der Aufgabenerledigung hat sich nach Einschätzung des Rechnungshofs bewährt und bringt keinen personellen Mehraufwand mit sich.
Nach Auffassung des Rechnungshofs ist eine zentrale Steuerung und Koordination zwingend notwendig. Dadurch können die Ziele und Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit für eine Zeitperiode besser vorgegeben und ziel- und wirkungsorientiert umgesetzt werden. Eine zentrale Steuerung ermöglicht eine bessere Priorisierung von Veröffentlichungen und Veranstaltungen. Problemfelder und Zielverfehlungen können hierdurch rechtzeitig erkannt und durch entsprechendes Gegensteuern behoben werden. Bei dezentralen Strukturen sind Broschüren und Veröffentlichungen sowie Veranstaltungen weitgehend vom Geschick und von der Routine der Fachabteilungen abhängig.
Deshalb plädiert der Rechnungshof für die Einrichtung einer eigenständigen Organisationseinheit Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit, die die Öffentlichkeitsarbeit des jeweiligen Hauses zentral durchführt und steuert.
3.2 Zentrale Servicestelle
Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit fallen eine Reihe von Aufgaben an, die völlig unabhängig vom Inhalt und dem Adressatenkreis der Publikation bzw. Veranstaltung, regelmäßig zu erledigen sind. Hierzu gehören insbesondere
- die Vorbereitung grafischer Leistungen (2,1 VZÄ),
- die grafischen Leistungen (4,1 VZÄ),
- die Ausschreibungen und Vergaben (2,1 VZÄ),
- die Durchführung von Veranstaltungen (12,9 VZÄ),
- die Beteiligung an Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen Dritter (3,3 VZÄ),
- der Druck (2,8 VZÄ) sowie
- der Vertrieb und der Versand (4,1 VZÄ).
Die Ressorts haben im Jahr 2005 für die vorgenannten Aufgaben insgesamt 31 VZÄ eingesetzt.
Diese operativen Tätigkeiten der Öffentlichkeitsarbeit - insbesondere das Veranstaltungsmanagement - gehören nicht zu den Kernaufgaben der Mitarbeiter in den Fachabteilungen der Ministerien und fallen auch nur temporär an. Dies schlägt sich in einem verhältnismäßig hohen Personaleinsatz nieder (siehe Tabelle 2) bzw. die Aufgaben werden an private Dienstleister vergeben.
Einige Ressorts haben den Beschaffungsprozess - insbesondere die Ausschreibungen - bereits im Erhebungszeitraum an das Logistikzentrum Baden-Württemberg delegiert.
Um die Schlagkraft der Öffentlichkeitsarbeit zu erhöhen und Synergien zu nutzen, sollte nach Auffassung des Rechnungshofs für den operativen Aufgabenbereich der Öffentlichkeitsarbeit ein für alle Ministerien einheitliches Servicezentrum eingerichtet werden, dem Teilaufgaben der Öffentlichkeitsarbeit übertragen werden könnten. Ähnlich einer privatwirtschaftlichen Agentur könnte das Servicezentrum die komplette Erstellung von Broschüren und Flyern sowie das Veranstaltungsmanagement für die Ministerien erledigen. Die Ministerien wären dabei weiter für die Ressortplanung, Steuerung und Koordination zuständig und müssten die inhaltliche Fachzuarbeit leisten. Ein solches Konzept würde den Zielsetzungen der Strukturkommission für Aufgabenkritik und Haushalt, welche die Schaffung von Servicezentren anstrebt, entsprechen. In einem ersten Schritt sollte daher die Einrichtung dieses Dienstleistungsbereiches im Zuge der vorgesehenen baulichen Zusammenführung der Ministerien eingeplant und umgesetzt werden.
Der Rechnungshof geht davon aus, dass durch eine zentrale Stelle - ausgestattet mit entsprechend geschultem, professionellem Personal - der bisherige Personaleinsatz für diese operativen Aufgaben von bisher mehr als 30 Stellen deutlich reduziert werden kann.
Zusätzlich zu den Synergien auf der Kostenseite ergeben sich für das Land weitere Vorteile. Unter anderem wäre auch eine bessere Information über die Terminierung von Veranstaltungen und die Herausgabe neuer Publikationen ressortübergreifend möglich.
Ein weiterer Kostenvorteil würde sich durch gebündelte Einkäufe ergeben. Durch erhöhte Ausschreibungsvolumina und das vorhandene Fach-Know-how werden sich im Regelfall kostengünstigere Lösungen und bessere Preise am Markt erzielen lassen. Das Land sollte auch beim Einkauf der für die Öffentlichkeitsarbeit benötigten Dienstleistungen von seiner Marktmacht als Großkunde Gebrauch machen.
4 Akquirierung von Drittmitteln
Die Ressorts konnten im Jahr 2005 durch die Generierung von Partnerleistungen ihren eigenen Mitteleinsatz für die Öffentlichkeitsarbeit zum Teil erheblich reduzieren.
Insgesamt wurden Drittmittel in Höhe von 2,36 Mio. € generiert. Bezogen auf die Sachkosten in Höhe von 8,72 Mio. € entspricht dies einem Anteil von rd. 27 %.
Der Anteil der Drittmittel an den Gesamtkosten schwankte bei den einzelnen Ministerien zwischen 0 % und 56 %. Am meisten Drittmittel haben - bezogen auf die Sachkosten - das Ministerium für Arbeit und Soziales und das Wissenschaftsministerium generieren können.
Der Rechnungshof empfiehlt, dass die Ministerien - anknüpfend an bereits beachtliche Erfolge einzelner Ressorts - in geeigneten Fällen auf die Suche nach Partnern und Sponsoren gehen, insbesondere zur Mitfinanzierung von Veranstaltungen und aufwendigen Publikationen. Dabei sind die Gefahren von entstehenden Abhängigkeitsverhältnissen jeweils im Einzelfall mit zu prüfen.
In der gemeinsamen Anordnung der Ministerien zur Förderung von Tätigkeiten des Landes durch Leistungen Privater (AnO Sponsoring) vom 06.11.2006 wird die Zulässigkeit des Sponsorings für Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit ausdrücklich bejaht.
5 Stellungnahme der Ministerien
Der Vorschlag zur Einrichtung einer eigenständigen Organisationseinheit für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit wird von den Ministerien differenziert bewertet. Während in einzelnen Ministerien die eigenständige Organisationseinheit bereits Realität ist, sehen andere Häuser eine Trennung wegen der geringen Mitarbeiteranzahl der mit Öffentlichkeitsarbeit betrauten Personen als wenig Ziel führend an, bzw. hielten eine enge Verzahnung der beiden Bereiche für effizient und sinnvoll. Bei einzelnen Ressorts würden die besonderen Fachaufgaben eine dezentrale Organisation verlangen.
Nach Auffassung der Ministerien ergäben sich durch die Schaffung eines Servicezentrums Öffentlichkeitsarbeit nur geringe Einsparpotenziale. Es werde eher befürchtet, dass hierdurch ein Mehraufwand, insbesondere für Koordinierung und Information, Doppelbefassungen und die Einweisung und Information einer fremden Stelle, und damit Mehraufwendungen entstünden. Ferner sei mit schwerfälligeren Abläufen und einer geringeren Flexibilität zu rechnen.
Die Empfehlung des Rechnungshofs im Bereich der Drittmittelakquirierung ist positiv aufgenommen worden.
6 Schlussbemerkung
Die Schaffung eigenständiger Organisationseinheiten für die Öffentlichkeitsarbeit hat sich nach Auffassung des Rechnungshofs bewährt. Wenn Ministerien, in denen die Öffentlichkeitsarbeit nur einen geringen Umfang einnimmt (z. B. Finanzministerium), diese Aufgaben weiterhin in der Pressestelle mit erledigen, muss von hier aus die ziel- und wirkungsorientierte Aufgabenwahrnehmung gewährleistet werden.
Der Rechnungshof bleibt bei seiner Empfehlung zur Bündelung der Serviceaufgaben in einem zentralen Servicezentrum Öffentlichkeitsarbeit. Die Bedenken der Ressorts hinsichtlich eines Mehraufwands wegen einer höheren Koordination, Doppelbefassungen und geringerer Flexibilität kann der Rechnungshof zwar nachvollziehen. Die Aufgabenerledigungen durch das Logistikzentrum Baden-Württemberg zeigen aber, dass zentrale Organisationslösungen sehr wohl Synergieneffekte generieren und die Aufgaben für die Ressort zufriedenstellend erledigt werden können.
Der Rechnungshof sieht sich in seinem Vorschlag zur Bildung eines zentralen Servicezentrums Öffentlichkeitsarbeit durch die aktuellen Überlegungen der Strukturkommission für Aufgabenkritik und Haushalt hinsichtlich der Bündelung von Serviceaufgaben bestätigt. Das Servicezentrum Öffentlichkeitsarbeit könnte ein Pilotprojekt für die Bündelung von Aufgaben darstellen.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Das Versorgungsrecht für Beamte ist in der Mehrzahl der Fälle einfach zu handhaben. Gleichwohl deckt die risikoorientierte Prüfung der Erstfestsetzung von Versorgungsbezügen durch die Finanzkontrolle regelmäßig Fehler auf. Diese Fehler könnten vermieden werden, wenn der Gesetzgeber das Versorgungsrecht weiter vereinfacht. Außerdem würde die Einführung einer elektronischen Versorgungsakte, die anlässlich der Einstellung des Beamten angelegt wird, die spätere Rekonstruktion der Biografie erleichtern.
1 Vorbemerkungen
Ein Beamter im Ruhestand erhält Versorgungsbezüge, deren Höhe sich gegenwärtig noch nach den Regeln des Beamtenversorgungsgesetzes des Bundes errechnet. Maßgeblich für die Höhe des Ruhegehalts sind danach einerseits die Höhe der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, die der Beamte vor Eintritt in den Ruhestand bezogen hat, andererseits die ruhegehaltfähige Dienstzeit, die er im Laufe seines Berufslebens zurückgelegt hat.
Zuständig für die Festsetzung der Höhe des Ruhegehalts eines Landesbeamten ist das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV). Die Sachbearbeitung im Einzelnen obliegt seit 01.11.2006 denselben Mitarbeitern, die auch die Besoldung des Beamten festgesetzt und administriert haben.
Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Stuttgart überprüft nach einem risikoorientierten System einerseits etwa ein Drittel der Erstfestsetzungsbescheide des Vorjahres, andererseits die Höhe der Versorgungsbezüge ausgewählter Geburtsjahrgänge. Schließlich werden auch jene Versorgungsfälle speziell geprüft, in denen besonders fehleranfällige Vorschriften des geltenden Versorgungsrechts anzuwenden sind.
Werden bei der Prüfung Fehler bei der Festsetzung der Versorgungsbezüge festgestellt, führt dies in der Regel zur Korrektur der Versorgungsbescheide, ggf. auch zur Rückforderung zu viel bezahlter bzw. zur Nachzahlung zu wenig bezahlter Versorgungsbezüge.
Die Tabelle zeigt die finanziellen Auswirkungen dieser Prüfungstätigkeit.
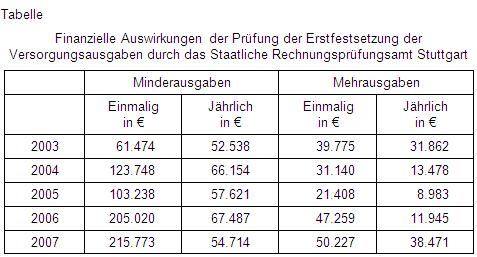
Im Falle jährlicher Minderausgaben können sich die Einsparungen für den Landeshaushalt im Einzelfall wegen der oft jahrzehntelangen Bezugsdauer der Versorgungsbezüge auf sechsstellige Beträge addieren.
Die finanziellen Erfolge dieser Prüfungstätigkeit rechtfertigen auch in Zukunft die im bundesweiten Vergleich hohe Prüfungsdichte, mit der sich die baden-württembergische Finanzkontrolle der Festsetzung von Versorgungsbezügen widmet.
2 Schwierigkeiten bei der Festsetzung der Versorgungsbezüge
Gegenüber anderen Versorgungssystemen (z. B. der gesetzlichen Rentenversicherung) zeichnet sich das Beamtenversorgungsrecht im Prinzip durch einfache und transparente Regeln aus. In etwa 85 % der Fälle kann die Erstfestsetzung deshalb ohne besondere Schwierigkeiten erfolgen und erweist sich auch bei der Prüfung in aller Regel als korrekt.
Das gilt insbesondere in jenen Fällen, in denen der Beamte, der in den Ruhestand tritt, sein gesamtes Berufsleben im Beamtenverhältnis verbracht hat und deshalb nicht über konkurrierende Ansprüche aus anderen Altersversorgungssystemen verfügt.
Schwierigkeiten ergeben sich hingegen dann, wenn neben dem Versorgungsrecht Anwartschaften aus anderen Altersversorgungssystemen zu berücksichtigen sind oder andere Sonderfälle vorliegen. Die wichtigsten Fallgruppen werden im Folgenden benannt:
2.1 Unzureichende Informationen über die berufliche Biografie des Beamten
In einer beachtlichen Zahl von Fällen ergeben sich bei der Ermittlung der ruhegehaltfähigen Dienstzeiten Schwierigkeiten, weil die Einzelheiten der oft jahrzehntelang zurückliegenden beruflichen Biografie des Beamten außerhalb des öffentlichen Dienstes kaum mehr aufzuklären sind.
Dies gilt insbesondere dann, wenn der Beamte vor dem Eintritt in den Ruhestand verstirbt und deshalb nicht mehr zur Aufklärung seiner Biografie beitragen kann. Der Ehegatte des Beamten, um dessen Versorgung es in diesen Fällen zumeist geht, verfügt häufig nicht über die zur Klärung der Biografie notwendigen Informationen.
Der Rechnungshof schlägt deshalb vor, zur Vermeidung solcher Defizite künftig für jeden Beamten schon bei Eintritt in den Dienst des Landes eine elektronisch geführte Versorgungsakte anzulegen, in die die zur späteren Versorgungsfestsetzung notwendigen biografischen Daten aufgenommen werden.
Neben Daten, die sich auf die Zeit vor dem Eintritt in das Beamtenverhältnis beziehen, könnte die elektronische Versorgungsakte auch zuverlässig darüber Auskunft geben, ob und ggf. wie lange der Beamte während seiner Dienstzeit ruhegehaltfähige Zulagen bezogen hat. Häufig sind diese in den Personalakten nicht zutreffend vermerkt.
2.2 Anrechnung von Renten
Wenn ein Beamter neben der beamtenrechtlichen Versorgung Renten aus der Sozialversicherung oder aus einer berufsständischen Versorgung bezieht, werden diese Renten nach Maßgabe des § 55 BeamtVG auf die Ruhegehaltsansprüche angerechnet.
Voraussetzung dafür ist, dass diese Rentenansprüche dem LBV bekannt sind.
Eine Prüfung des Rechnungshofs im Jahr 2004, bei der die Daten des LBV mit den Daten der gesetzlichen Rentenversicherung abgeglichen wurden, ergab, dass nicht in allen Fällen ein Rentenbezug beim LBV bekannt ist (siehe Denkschrift 2006, Beitrag Nr. 5, Anrechnung von Renten auf Versorgungsbezüge).
Der Rechnungshof hat deshalb vorgeschlagen, eine ausreichende Rechtsgrundlage dafür zu schaffen, die das LBV ermächtigt, die Daten der Versorgungsempfänger mit den Daten der Rentenversicherungen abzugleichen.
2.3 Anrechnung nicht in Anspruch genommener Renten
In bestimmten Fällen werden vom Beamten nicht in Anspruch genommene Renten auf das Ruhegehalt angerechnet. In diesen Fällen ist ein Datenabgleich nicht zielführend, da keine Zahlungen an den Ruhestandsbeamten erfolgen.
Aufklärbar sind diese Fälle nur, wenn sich die fiktiven Rentenansprüche aus den Angaben oder der Biografie des Beamten ergeben. In jedem Fall ist ein erheblicher Bearbeitungsaufwand erforderlich, zudem sind sie besonders fehleranfällig.
2.4 Fälle, in denen ein Versorgungsausgleich stattgefunden hat
Die familienrechtlichen Regelungen über den Versorgungsausgleich sind überaus kompliziert und führen in einer nennenswerten Zahl von Fällen ebenfalls zu Fehlern bei der Festsetzung der Versorgungsbezüge.
Hier ist der Bundesgesetzgeber aufgefordert, auf eine Vereinfachung des Rechts des Versorgungsausgleichs hinzuarbeiten.
2.5 Anrechenbare Zeiten bei Professoren
Nach § 67 Beamtenversorgungsgesetz sind bei Professoren auch bestimmte Zeiten vor der Berufung ins Professorenverhältnis als ruhegehaltfähige Dienstzeiten anzurechnen (z. B. die Zeit zur Vorbereitung auf die Promotion).
Auch bei der Anwendung dieser Vorschrift kommt es gelegentlich zu Schwierigkeiten und Fehlern, da sich die anrechenbaren Zeiten oft nur noch unzureichend rekonstruieren lassen. Dies gilt insbesondere dann, wenn nicht bereits bei der Berufung des Professors verbindlich entschieden worden ist, welche Vordienstzeiten ruhegehaltsfähig sind.
Der Landesgesetzgeber sollte bei der anstehenden Neuregelung das Versorgungsrecht für Professoren vereinfachen (z. B. durch eine stärkere Pauschalierung oder eine Pflicht zur Vorabentscheidung), um die Fehleranfälligkeit dieser Normen zu vermindern.
2.6 Auf Initiative des Rechnungsprüfungsamts behobene Schwierigkeiten
Als schwierig und fehleranfällig erwies sich in der Vergangenheit die Verteilung der Versorgungslasten, wenn der Beamte im Laufe seines Berufslebens den Dienstherrn gewechselt hat (§ 107 b Beamtenversorgungsgesetz). Auf Vorschlag des Staatlichen Rechnungsprüfungsamts Stuttgart wurde hierzu vom LBV ein neuer Berechnungsvordruck eingeführt, durch den diese Vorschrift jetzt nahezu fehlerfrei angewendet wird.
Auch die Berechnung der Kindererziehungszuschläge nach § 50 a Beamtenversorgungsgesetz erwies sich in der Vergangenheit als ausgesprochen fehleranfällig. Hier hat ein neu eingeführtes DV-Programm dazu geführt, dass die Fehlerquote des LBV in diesem Bereich nunmehr gegen null geht.
3 Vorschläge für Neuregelungen im Versorgungsrecht
Durch die im Jahr 2006 in Kraft getretene Föderalismusreform I ist die Gesetzgebungszuständigkeit für das Recht der Beamtenversorgung auf die Länder übergegangen.
Der Landtag wird voraussichtlich noch in dieser Legislaturperiode ein neues Versorgungsrecht für die Beamten des Landes, der Kommunen und der der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften und Anstalten verabschieden.
Der Landesgesetzgeber sollte bei der anstehenden Novellierung das Versorgungsrecht noch weiter vereinfachen und die oben genannten Fehlerquellen ausschließen.
Insbesondere die vom Rechnungshof in den letzten Jahren mehrfach angemahnte Trennung der Versorgungssysteme würde die aufwendige und fehleranfällige Verrechnung von Renten und Versorgungsbezügen auf lange Frist beseitigen. Ein Beamter, der vor seiner Berufung in das Beamtenverhältnis Rentenanwartschaften erworben hat, könnte diese dann neben seinen Versorgungsbezügen geltend machen. Die rentenversicherungspflichtigen Zeiten müssten im Gegenzug nicht mehr als ruhegehaltfähige Dienstzeiten angerechnet werden.
4 Stellungnahme des Ministeriums
Das Finanzministerium hat keine grundsätzlichen Einwendungen gegen die Feststellungen und die Folgerungen des Rechnungshofs. Die vorgeschlagenen Rechtsänderungen werde es im Zuge des anstehenden Gesetzgebungsverfahrens prüfen.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Die bereits 2005 auf Vorschlag des Rechnungshofs vom Landtag geforderte Aufgabenbündelung beim Betrieb von Datennetzen wurde bislang noch nicht umgesetzt. Durch die Verwendung neuer Techniken und die Verbesserung der Konditionen bestehender Verträge hat das Innenministerium zwar dafür gesorgt, dass Datenleitungen zu einem günstigeren Preis-Leistungs-Verhältnis bezogen werden. Jedoch sind weitere Preisreduzierungen durch eine Neuausschreibung möglich.
1 Vorbemerkung
Das Landesverwaltungsnetz (LVN) ist das Weitverkehrsdatennetz der Landesverwaltung. Es dient der elektronischen Kommunikation zwischen den Dienststellen und ermöglicht Zugriffe auf IuK-Anwendungen und -Verfahren der Landesverwaltung. Der Rechnungshof hat das LVN zuletzt 2004 geprüft und darüber berichtet (Denkschrift 2005, Beitrag Nr. 5, Wirtschaftlichkeit des Landesverwaltungsnetzes).
2007 hat sich der Rechnungshof erneut dem Thema LVN zugewandt, um zu untersuchen, inwieweit die Vorschläge aus dem Jahr 2005 umgesetzt wurden. Außerdem sollte untersucht werden, wie sich die technischen und vertraglichen Änderungen der letzten Jahre ausgewirkt haben.
2 Struktur und Kosten des Landesverwaltungsnetzes
An das Landesverwaltungsnetz sind 1.430 Dienststellen der Landesverwaltung angeschlossen. Zudem gibt es 1.275 Zugänge für Telearbeitsplätze und mobile Nutzer.
Etwa 1.540 Anschlüsse und Verbindungen bezieht die Landesverwaltung aus einem Outsourcing-Vertrag. Dabei bietet der Vertragspartner Anschlüsse in unterschiedlichen Basistechnologien, unterschiedlichen Übertragungsraten und unterschiedlichen Verfügbarkeitszusicherungen an. Bei manchen Anschlusstypen hat die Landesverwaltung dabei die Wahlmöglichkeit, ob sie die Netzwerktechnik vor Ort selbst bereitstellen und betreuen will oder ob dies der Outsourcing-Partner übernimmt. Weitere 100 Dienststellen des Landes sind über Glasfaserstrecken verschiedener Anbieter an das LVN angebunden (sogenanntes Metronetz). Zugänge für Telearbeitsplätze und mobile Nutzer werden teilweise aus dem Outsourcing-Vertrag genutzt, einige Ressorts haben für diesen Zweck jedoch jeweils eine eigene Infrastruktur aufgebaut.
Das LVN verursacht jährliche Kosten in Höhe von 18,4 Mio. €, davon etwa 2,6 Mio. € Personalkosten. Der Outsourcing-Partner erhält jährlich etwa 12,5 Mio. €. In den Gesamtkosten sind die Kosten für die Messnetze der Umweltverwaltung sowie der Datenleitungen für die Fernüberwachung der Kernreaktoren nicht enthalten.
3 Vorschläge des Rechnungshofs aus dem Jahr 2005
Der Rechnungshof hatte damals festgestellt und gefordert:
- In der Landesverwaltung wird an zu vielen Stellen Sachverstand für Datennetze vorgehalten. Die zur Betreuung des Netzbetriebs notwendigen Teilaufgaben sollten vom Landesbetrieb Informatikzentrum Landesverwaltung Baden-Württemberg (Informatikzentrum) gebündelt wahrgenommen werden.
- Zum Teil waren Datenleitungen nur gering ausgelastet oder ungenutzt. Die Landesbehörden sollten verpflichtet werden, die Dimensionierung der Datenleitungen laufend hinsichtlich Notwendigkeit und Kosten zu überprüfen. Das Berichtswesen sollte verbessert werden.
- Seit dem Vertragsabschluss Ende 1999 wurden Preisanpassungen mit dem Outsourcing-Partner frei verhandelt. Als Reaktion auf inzwischen eingetretene Technik- und Marktveränderungen sollte eine Neuausschreibung bis 2009 vorbereitet werden.
- Landes- und Kommunalverwaltung nutzen unterschiedliche Datennetze, die aber vom selben Auftragnehmer zur Verfügung gestellt werden. Nach der Verwaltungsstrukturreform werden jedoch viele IuK-Verfahren gemeinsam genutzt, was eine Zusammenlegung der Netze nahe legt. Die Zusammenarbeit zwischen dem Land und den kommunalen Netzbetreibern sollte daher so eng wie möglich gestaltet werden.
Der Landtag hat sich den Forderungen des Rechnungshofs angeschlossen.
4 Stand der Umsetzung
4.1 Bündelung von Aufgaben
Die zur Betreuung des Netzbetriebs in der Landesverwaltung notwendigen Teilaufgaben wurden bisher nicht weiter gebündelt. Nach wie vor beschäftigen sich Mitarbeiter in mehreren Bereichen der Landesverwaltung mit Netzplanung, Netzbetrieb und Netzwerksicherheit. Sachverstand für derart spezielle Themen an so vielen Stellen vorzuhalten, ist nicht wirtschaftlich. Beispielsweise gehören Fragen der Ausgestaltung und des Betriebs von Firewall-Systemen nicht zu den Aufgaben einer Fachbehörde. Erst nachdem auch ein externer Berater die Empfehlungen des Rechnungshofs bestätigt hat, laufen nun die ersten Aktivitäten zur Aufgabenbündelung an.
Betroffene Ministerien geben Zuständigkeiten nur ungern an das Informatikzentrum ab und bezeichnen viele ihrer Aufgaben als fachspezifische Besonderheiten, anstatt sich auf eine gemeinsame zentrale Lösung einzulassen.
Die Regierung hat die Notwendigkeit weiterer Bündelung der noch viel zu zersplitterten IuK-Landschaft erkannt, aber bisher noch nicht gehandelt.
4.2 Nutzung und Dimensionierung der Datenleitungen
Bei der Nachschau hat der Rechnungshof erneut etwa 50 ungenutzte Anschlüsse vorgefunden, was zeigt, dass noch immer kein wirksamer Kontrollmechanismus eingeführt ist. Sowohl die nutzenden Ressorts als auch das Informatikzentrum messen dem Thema Leitungscontrolling nach wie vor nicht die notwendige Bedeutung bei. Zudem sind auch die vom Outsourcing-Partner gelieferten Statistiken nicht dafür geeignet, betroffene Anschlüsse ohne zusätzlichen Aufwand zu ermitteln.
Allein die über DSL-Technik an das LVN angeschlossenen Notariate könnten bei der Verwendung von asymmetrischen, d. h. geringer dimensionierten, Anschlüssen und durch Verzicht auf eine Back-up-Leitung jährlich 1,1 Mio. € sparen.
Die Auslastungsstatistiken zeigen zwar gegenüber 2004 ein positiveres Bild. Eine Änderung der Übertragungsrate wird jedoch meist nur dann in Betracht gezogen wird, wenn diese möglicherweise zu gering ist und es zu Performance-Engpässen kommt, nicht jedoch im umgekehrten Fall.
4.3 Neuausschreibung
Im November 2007 hat das Innenministerium dem Rechnungshof mitgeteilt, dass es plant, den Outsourcing-Vertrag um weitere drei Jahre auf dann zwölf Jahre Laufzeit zu verlängern. Im Zuge der Diskussion mit dem Rechnungshof ist das Ministerium von dieser Absicht abgerückt und bereitet eine Neuausschreibung vor.
4.4 Zusammenführung des Landesverwaltungsnetzes und der kommunalen Verwaltungsnetze
Nach der Verwaltungsstrukturreform werden viele zentrale IuK-Verfahren der Landesverwaltung auch von den Kommunen genutzt. Da Land und Kommunen zwei getrennte Datennetze haben, müssen die Daten über zwei Netze hinweg übertragen werden. Die Vielzahl der beteiligten technischen Komponenten und die unterschiedlichen Zuständigkeiten können die Fehlersuche im Störungsfall erschweren. Eine Zusammenführung der Netze ist daher aus technischer, wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht anzustreben.
Die Überlegung, die kommunalen Datennetze bei der nächsten Ausschreibung mit einzubeziehen, verfolgt das Innenministerium allerdings nicht weiter, weil durch die Bündelung des Bedarfs über Verwaltungsebenen hinweg ein unzulässiges Nachfragekartell entstehe.
5 Weitere Feststellungen
5.1 Preiskonditionen
Im Outsourcing-Vertrag wurden inzwischen die Preise um etwa 12 % reduziert, und es wurden auf DSL-Technologie basierende Anschlüsse neu in das Leistungsangebot aufgenommen. Die Preise dafür wurden frei vereinbart, eine Ausschreibung fand nicht statt. Ob auf diese Weise die günstigsten Konditionen erzielt wurden, erscheint dem Rechnungshof sehr fraglich. Die Polizei und die Schulverwaltung beziehen vergleichbare Anschlüsse (am landeseigenen Informatikzentrum vorbei) von einem anderen Anbieter zu Preisen, die teilweise nur etwa ein Viertel der Preise des Outsourcing-Vertrags betragen. Wären alle DSL-Anschlüsse entsprechend günstiger, könnten jährlich etwa 2,5 Mio. € gespart werden.
5.2 Verschlüsselungstechnik
Zur Verschlüsselung auf Netzwerkebene nutzt die Polizei zwei verschiedene technische Lösungen mit separaten Verschlüsselungsgeräten. Die aus dem Outsourcing-Vertrag bezogene Technik ist etwa achtmal so teurer wie die eigene Lösung des Landeskriminalamts. Würde für alle Polizeidienststellen die kostengünstigere Lösung eingesetzt, könnten jährlich 380.000 € gespart werden.
5.3 Schnittstellen zum Internet
Neben einem vom Informatikzentrum zentral bereitgestellten und hochverfügbaren Übergang vom LVN zum Internet haben einige Ressorts noch eigene Übergänge zum Internet. Für jeden dieser Übergänge müssen Sicherheitsvorkehrungen technischer und organisatorischer Art getroffen werden. Die dafür notwendigen Kosten fallen daher mehrfach an. Durch die gemeinsame Nutzung des zentralen Zugangs könnten Sach- und Personalkosten gespart, die Verfügbarkeit für die bislang nicht redundant angebundenen Ressorts erhöht und die Sicherheit des LVN insgesamt verbessert werden.
5.4 Externe Zugänge
Die Zugänge von außen in das LVN (Remote-Zugänge) wurden nicht vereinheitlicht. Die dafür erforderliche Technik wird von mehreren Ressorts vorgehalten. Durch Nutzung einer gemeinsamen Lösung könnten auch hier die Kosten reduziert werden.
6 Jahresvergleich
Nicht nur durch die allgemeine Entwicklung auf dem Netzsektor, sondern auch durch Aktivität des Innenministeriums haben sich die Kosten je MBit/s Übertragungskapazität deutlich reduziert, wie die Tabelle zeigt.
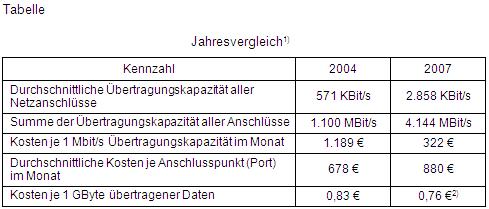
Die durchschnittliche Übertragungsgeschwindigkeit und die Gesamtsumme der Übertragungskapazität aller Anschlüsse haben sich gegenüber 2004 verfünf- bzw. vervierfacht, die Kosten je Megabit sind jedoch um rund 70 % gesunken. Der Grund hierfür liegt vor allem in der höheren Kapazität und dem besseren Preis-/Leistungsverhältnis der vom Informationszentrum ausgeschriebenen und administrierten staatlichen Metronetzverbindungen. Durch die Verwaltungsstrukturreform sind die LVN-Netzanschlüsse der Behörden, die in die Stadt- und Landkreise überführt wurden, größtenteils weggefallen. Da es sich hierbei vorwiegend um kleinere Behörden mit preisgünstigen Anschlüssen niedrigerer Übertragungsraten handelte, wirkt sich dies in der Erhöhung der durchschnittlichen Port-Kosten aus.
7 Neuere Entwicklungen
7.1 Zentrale Netzwerk-Infrastruktur
Durch gemeinsame Nutzung der Netzwerk-Infrastruktur für Datenübertragung und Telefonie können neue Einsparpotenziale erschlossen werden. Für die Themen Datennetze und Telefonie sind in der Landesverwaltung jedoch unterschiedliche Ministerien federführend, was die Festlegung einer einheitlichen Strategie erschwert.
7.2 Digitalfunk
Derzeit wird bundesweit die Infrastruktur für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben errichtet. Für die Vernetzung der Basisstationen mit den Vermittlungsstellen sind dabei die Länder verantwortlich. Die Landesverwaltung plant, hierfür ein zusätzliches, größtenteils auf Richtfunkstrecken basierendes Datennetz (sogenanntes Zubringernetz) neu aufzubauen und dieses zunächst durch eine eigene Betriebsorganisation bei einer Polizeieinrichtung betreuen zu lassen.
Es gibt Überlegungen, das Digitalfunk-Zubringernetz auch für die Datenkommunikation der Polizeidienststellen und ggf. weiterer Landesbehörden mit zu verwenden, sodass auf einen Teil der bisherigen LVN-Anschlüsse verzichtet werden könnte.
Das Innenministerium hält eine eigene Betriebsorganisation für die Aufbauphase für zwingend erforderlich. Nach vollständigem Aufbau und stabilem Netzbetrieb sei ein Outsourcing an das Informatikzentrum oder einen anderen Betreiber möglich. Das Thema der möglichen Synergien durch Mitnutzung des Zubringernetzes für die Datenkommunikation soll im Laufe des Ausbaus stufenweise angegangen werden.
8 Wertung und Vorschläge
Das Innenministerium hat durch den Aufbau des Metronetzverbunds und die Anpassung des Vertragswerks an die technische Entwicklung und infolge der Preisbewegungen im Markt erreicht, dass bei etwa gleich bleibenden Ausgaben höhere Übertragungsraten zur Verfügung stehen. Die Vorschläge des Rechnungshofs aus dem Jahr 2005 zur Aufbau- und Ablauforganisation wurden allerdings bislang größtenteils noch nicht umgesetzt. Weiterhin gilt:
- Die Aufgabenbündelung für Netzwerkthemen beim Informatikzentrum des Landes sollte nun unverzüglich vorangetrieben werden.
- Unter Berücksichtigung sicherheitstechnischer Anforderungen sollte die Zahl der Netzübergänge zum Internet reduziert werden.
- Bei den Zugängen von außen in das LVN sollten die technischen Lösungen vereinheitlicht werden.
- Sicherzustellen ist, dass ungenutzte Anschlüsse so bald wie möglich gekündigt werden.
Das Informatikzentrum sollte seine Rolle nicht nur als Moderator sehen, sondern in zweifacher Hinsicht aktiver wahrnehmen:
- Das vom Outsourcingpartner gelieferte Statistikmaterial ist zur Steuerung nur sehr bedingt geeignet; überdies kamen die vereinbarten Informationen mit bis zu neun Monaten Verzögerung. Hier muss das Informatikzentrum auf die Einhaltung der vertraglichen Regelung bestehen.
- Selbstverständlich sind die Ministerien als Besteller für die Leitungsdimensionierung verantwortlich. Trotzdem muss das Informatikzentrum diese zeitnah auf kaum oder nur wenig genutzte Leitungen und deren Kosten hinweisen.
Darüber hinaus sollten bei der künftigen Ausrichtung des LVN folgende Punkte beachtet werden:
- Durch Zusammenführung der Zuständigkeit für Telefonie (Finanzministerium) und Datennetz (Innenministerium) ergäben sich bessere Steuerungs- sowie Einsparmöglichkeiten bei der Mitnutzung von Datennetzen für die Sprachübertragung.
- Intensiv sollte geprüft werden, ob eine Zusammenlegung von LVN und den kommunalen Datennetzen möglich und wirtschaftlich ist.
Der Rechnungshof verkennt nicht die große technische Herausforderung beim Aufbau des Digitalfunk-Netzes. Trotzdem müssen die möglichen Synergien durch einen gemeinsamen Netzbetrieb und der Mitnutzung der Datenübertragungsstrecken kontinuierlich im Auge behalten werden. Der zunächst gewählte Weg der parallelen Betriebszuständigkeit ist nicht optimal. Da sich Organisationsstrukturen später oftmals nur schwer ändern lassen, wäre es besser, die Aufgaben bereits von Anfang an bei dem in der Landesverwaltung für den Netzbetrieb zuständigen Informatikzentrum anzusiedeln.
Insbesondere die gravierenden Preisunterschiede bei den DSL-Anschlüssen zeigen, dass die Ermittlung aktueller marktüblicher Preise durch Wettbewerb überfällig ist. Gleichwohl sollte das Innenministerium auch beim laufenden Outsourcing-Vertrag auf deutliche Preisnachlässe bestehen.
9 Stellungnahme der Ministerien
Das Innenministerium begrüßt die Vorschläge des Rechnungshofs zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und insbesondere auch zur IuK-Bündelung. Soweit sie bisher noch nicht im vom Rechnungshof erwarteten Umfang umgesetzt werden konnten, sei dies teilweise in den rechtlichen, politischen und sicherheitstechnischen Rahmenbedingungen begründet, die auch weiterhin Gültigkeit hätten. Gleichwohl würden die Vorschläge des Rechnungshofs in den anstehenden IuK-Projekten der Stabsstelle berücksichtigt werden. So würden etwa die Hinweise zum Berichtswesen und zur Abrechnung in die geplante Neuausschreibung des Landesverwaltungsnetzes Eingang finden. Auch die staatlich-kommunale Zusammenarbeit im Bereich der Verwaltungsnetze und die Zusammenarbeit hinsichtlich der Konvergenz der Sprach- und Datenkommunikation würden intensiviert werden.
Das Umweltministerium und das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum halten die Bündelung des Sachverstandes für Netzthemen beim Informatikzentrum nicht für möglich, da es zur Konzeption von Fachanwendungen unabdingbar sei, in Entwicklungsabteilungen eigenes Netzwerk-Know-how vorzuhalten. Der Netzbetrieb falle dabei quasi nebenbei an. Der Sachverstand werde auch für Verhandlungen mit dem Netzbetreiber, für Abschätzung von Leitungsdimensionierungen und bei der Störungsbeseitigung komplexer Fehlersituationen benötigt. Das Umweltministerium bezweifelt zudem, dass ein zentraler Übergang zum Internet wirtschaftliche Vorteile brächte, ohne dies zu belegen.
Das Innenministerium weist auf die Besonderheiten der Polizei hin, die gegen eine Zentralisierung der Technik und Aufgaben sprächen.
Das Justizministerium teilt die Meinung des Rechnungshofs nicht, dass es bei der Netzanbindung der Notariate Einsparpotenzial gebe. Bei einem Back-up-Verzicht der Notariatsanschlüsse sei bei Leitungsausfall ein Zugriff auf das Grundbuch nicht mehr möglich. Hinsichtlich der Netzdimensionierung beruft es sich auf Expertenrat.
10 Schlussbemerkung
Das Thema Datennetze ist von einer starken Dynamik geprägt. Innenministerium und Informatikzentrum ist es gemeinsam gelungen, das Landesverwaltungsnetz laufend an den aktuellen Stand der Technik anzupassen. Trotzdem gibt es Einsparmöglichkeiten, die genutzt werden sollten. Das Innenministerium verfolgt die richtige Strategie. Die Stellungnahmen der Polizei, des Umweltministeriums und des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum betonen die von ihnen empfundenen Besonderheiten zu stark. Angebracht wäre stattdessen die Suche nach wirtschaftlicheren gemeinsamen Lösungen.
Die Meinung, dass Ministerien Netzwerkspezialisten selbst vorhalten müssen, teilt der Rechnungshof nicht. Da sich die Ministerien noch immer bei sehr vielen Projekten von Externen gegen hohe Bezahlung beraten lassen, können sie sich auch vom landeseigenen Informatikzentrum unterstützen lassen, wenn der Netzsachverstand dort gebündelt und vertieft worden ist.
Die Ausführungen des Justizministeriums zeigen, dass Wünsche der Experten leicht zu Aufträgen an die IuK werden. Auffallend ist, dass das Unternehmen, das die hohe Leitungskapazität vorschlägt, diese auch selbst liefert. Messungen zeigen allerdings, dass die Leitungen zu den Notariaten überdimensioniert sind. Die Verfügbarkeit der vom Rechnungshof vorgeschlagenen Lösung ist um ein Vielfaches höher als die bisherige Auskunftsfähigkeit der Notariate per Telefon oder Schriftverkehr. Eine „Echtzeitverarbeitung“ gab es auch bisher nicht. Für das Grundbuch ist im Übrigen der Wahrheitsgehalt entscheidend, nicht der elektronische Zugriff im Sekundenbereich.
Die Position der Polizei, ihrem Netzwerkdienstleister (Informatikzentrum) die Netzfragen für den Digitalfunk nicht zu übertragen und stattdessen einen weiteren Netzdienstleister für die Polizei aufzubauen, ist schwer verständlich.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Die von der Leitstelle für Arzneimittelüberwachung erhobenen Gebühren sind nicht kostendeckend. Durch eine zutreffende Gebührenfestsetzung und organisatorische Maßnahmen könnten Mehreinnahmen von jährlich mehreren Hunderttausend Euro erzielt werden. Bei Auslandsdienstreisen der Mitarbeiter sollte einer latenten Korruptionsgefahr durch geeignete Maßnahmen vorgebeugt werden.
1 Ausgangslage
Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Tübingen prüfte die Gebühreneinnahmen der Leitstelle Arzneimittelüberwachung Baden-Württemberg (Leitstelle) beim Regierungspräsidium Tübingen. Untersucht wurde auch, inwieweit die Beschlüsse des Ministerrats aus dem Jahr 2000 zur Einrichtung einer landesweit zuständigen Leitstelle beim Regierungspräsidium Tübingen umgesetzt wurden.
2 Errichtung der Leitstelle und Umsetzung der Ministerratsbeschlüsse
2.1 Errichtung der Leitstelle
Für Baden-Württemberg ist die pharmazeutische Industrie ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. In rd. 400 Unternehmen, die zusammen einen Jahresumsatz von mehr als 8 Mrd. € erzielen, sind rd. 35.000 Mitarbeiter beschäftigt. Mit einem Exportvolumen von 3,4 Mrd. € steht die pharmazeutische Industrie in Baden-Württemberg bundesweit an der Spitze.
Die Unbedenklichkeit der Herstellung von Arzneimitteln muss staatlich testiert werden, damit die Pharmaunternehmen ihre Produkte herstellen dürfen. Ende der Neunzigerjahre waren für diese sogenannte Herstellerüberwachung noch alle vier Regierungspräsidien des Landes zuständig.
Veränderte Rahmenbedingungen, wie
- erhöhte Anforderungen an die Sicherheit von Arzneimitteln, Medizinprodukten, Blut und Blutprodukten,
- zunehmende europäische und internationale Unternehmensverflechtungen sowie
- die Umsetzung neuer Gesetze (wie z. B. die Novellierung des Arzneimittelgesetzes und des Medizinproduktegesetzes) und die Intensivierung der Überwachungsaufgaben,
machten es jedoch notwendig, die Überwachungsstrukturen neu zu ordnen.
Auf der Basis einer entsprechenden Kabinettsvorlage des Ministeriums für Arbeit und Soziales beschloss der Ministerrat am 18.01.2000 die Neuordnung der Arzneimittelüberwachung. Hierzu sollten u. a.
- die bisherigen Stellen des höheren Dienstes für die Herstellerüberwachung der vier Regierungspräsidien bei der neu geschaffenen Leitstelle beim Regierungspräsidium Tübingen zusammengeführt,
- drei neue Stellen des höheren Dienstes zur Intensivierung der Überwachungsaufgaben gegen Stellenwegfall an anderer Stelle geschaffen sowie
- drei Stellen des gehobenen Dienstes - zunächst ohne Stellenübertragung - der Leitstelle beim Regierungspräsidium Tübingen unterstellt
werden.
2.2 Umsetzung der Ministerratsbeschlüsse und Auswirkung auf die Aufgabenerledigung
Die vom Ministerrat beschlossenen Personalmaßnahmen sind nur für den höheren Dienst umgesetzt worden. Im gehobenen Dienst verfügt die Leitstelle beim Regierungspräsidium Tübingen hingegen nach wie vor nur über eine Personalstelle zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben. Das bisherige Verwaltungspersonal bei den übrigen Regierungspräsidien ist mittlerweile mit anderen Aufgaben befasst.
Die Leitstelle und das Ministerium für Arbeit und Soziales haben wiederholt angeregt, auch die Stellen des gehobenen Dienstes auf das Regierungspräsidium Tübingen zu übertragen, was von den übrigen Regierungspräsidien abgelehnt wurde. Zwar verständigten sich das Innenministerium und das Ministerium für Arbeit und Soziales darauf, Personalengpässe im Verwaltungsbereich der Leitstelle durch Aufgabenverlagerung auf die übrigen Regierungspräsidien zu überbrücken. Die Leitstelle hat jedoch bislang auf einen solchen Abruf von Arbeitskapazitäten verzichtet, weil eine dezentrale Erledigung der fraglichen Tätigkeiten weder praktikabel noch wirtschaftlich sei.
Die zuvor dezentral von Bediensteten des gehobenen Dienstes erledigten Verwaltungsaufgaben müssen deshalb auch von den Arzneimittelinspekteuren des höheren Dienstes wahrgenommen werden. Hierzu gehören beispielsweise die Ausfertigung von weit über tausend Erlaubnissen und Zertifikaten oder die Ermittlung der Grundlagen für die Gebührenerhebung. Die Belastung der Arzneimittelinspekteure durch Verwaltungsaufgaben hat u. a. zur Folge, dass der gesetzlich vorgegebene zweijährige Prüfungsturnus für Regelinspektionen nicht mehr eingehalten werden kann.
3 Feststellungen zu den Gebühreneinnahmen
Die Leitstelle erhebt für Inspektionen bei Unternehmen im In- und Ausland, für die Erteilung von Zertifikaten und Erlaubnissen sowie für allgemeine Überwachungsaufgaben Gebühren nach dem Landesgebührengesetz. Die einzelnen Gebührentatbestände sind in der Gebührenverordnung des Ministeriums für Arbeit und Soziales geregelt.
3.1 Rechtzeitigkeit und Vollständigkeit der Gebührenerhebung
Die Gebühren wurden häufig mit erheblichen zeitlichen Verzögerungen festgesetzt; Zinsausfälle waren die Folge. Nach Feststellung der jeweiligen Tatbestände vergingen bis zum Erlass von Gebührenbescheiden im Durchschnitt 98 Tage. Außerdem waren sieben Fälle des Jahres 2005 nicht abgerechnet worden. Ohne entsprechende Hinweise des Staatlichen Rechnungsprüfungsamts Tübingen hätte das Land rd. 20.000 € weniger eingenommen.
Für solche Gebührenausfälle und Zinsverluste sind vor allem fehlende Kontrollmechanismen und eine unzureichende Standardisierung von Arbeitsabläufen verantwortlich. Wäre der Verlagerung der Arzneimittelüberwachung auf das Regierungspräsidium Tübingen auch das entsprechende Verwaltungspersonal der übrigen Regierungspräsidien gefolgt, hätten die Festsetzungsverfahren beschleunigt werden können. Dann verbliebe den Arzneimittelinspekteuren die erforderliche Zeit für ihre Kernaufgaben mit der Folge, dass zusätzliche Gebühreneinnahmen auch ohne neue Stellen des höheren Dienstes erzielt werden könnten.
3.2 Kostendeckungsgrad
Für die Bemessung der Gebühren gelten die Grundsätze des § 7 Landesgebührengesetz. Die Leitstelle hat jedoch das darin festgelegte Kostendeckungsgebot nicht ausreichend berücksichtigt. In der Tabelle sind die Gebühreneinnahmen der Leitstelle dem Personalaufwand der Arzneimittelinspekteure, einschließlich der Gemeinkostenzuschläge für Raum- und Sachkosten , gegenübergestellt. Der Aufwand für gebührenpflichtige Tätigkeiten wurde anhand der Angaben und Aufzeichnungen der Leitstelle hochgerechnet. Hiernach ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von 56 %.
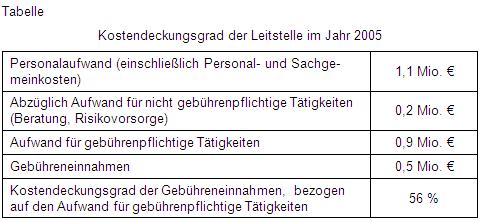
Gegenüber dem gebührenpflichtigen Personalaufwand weisen die Ist-Einnahmen eine Unterdeckung von mehr als 400.000 € aus. Die wichtigsten Gründe dafür sind:
- Der Gebührenrahmen wird selten ausgeschöpft. Einige der von der Leitstelle erhobenen Pauschalgebühren liegen in der unteren Hälfte des gesetzlichen Gebührenrahmens.
- Ein seit 2002 speziell für Regelinspektionen angewendetes Gebührenmodell führte in den Jahren 2004 und 2005 zu Mindereinnahmen von 55.000 €.
- Für bestimmte Arbeiten fehlt der Ansatz des personellen Zeitaufwands oder er ist unzureichend bemessen, und zwar
- für die Nachbereitung von Inspektionen im Umfang von 50.000 €,
- für besondere Qualifizierungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung der Prüfungsberechtigung der Arzneimittelinspekteure im Umfang von 110.000 € und
- für die Gebührenberechnung und -festsetzung durch Mitarbeiter der Verwaltung im Umfang von 41.000 €.
Die Leitstelle hat teilweise bereits auf die Prüfungsergebnisse der Finanzkontrolle reagiert und das Gebührenmodell in Abstimmung mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales überarbeitet.
Die neuen Gebührensätze müssen jedoch noch auf der Grundlage einer umfassenden Analyse der Kostenstrukturen mit Blick auf entsprechende Deckung der Personal- und Sachkosten überprüft werden. Das gesamte Gebührenaufkommen muss auf die Deckung des Gesamtaufwands des betreffenden Leistungszweigs ausgerichtet und beschränkt sein.
3.3 Kostenrechnung und Personalbedarf
Die derzeitige Kostenrechnung der Leitstelle lässt keine Aussage über den Aufwand für die einzelnen Tätigkeitsfelder der Arzneimittelinspekteure zu, weil nur ein Globalprodukt „Leitstelle“ bebucht wird. Die erhobenen Gebühren beruhen teilweise auf Zeitschätzungen für den tätigkeitsbezogenen Aufwand. Der Leitstelle fehlen damit steuerungsrelevante Informationen und Berechnungsgrundlagen für die Ermittlung des zur Aufgabenerledigung notwendigen Personals.
Dem Regierungspräsidium Tübingen wird deshalb empfohlen, in der Kostenrechnung für die Leitstelle unterschiedliche Produkte - entsprechend den einzelnen Aufgaben der Arzneimittelinspekteure - zu bilden und mit den angefallenen Personal- und Sachkosten zu bebuchen. Die Ermittlung dieser Datenbasis setzt allerdings eine Überprüfung der derzeitigen Arbeitsabläufe unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten voraus, damit nur der notwendige Aufwand in die Gebührenfestsetzung einfließt.
Die durch umgeschichtetes Verwaltungspersonal sowie optimierte Strukturen und Abläufe frei werdenden Prüferkapazitäten sind zu ermitteln. Erst dann kann über das von der Leitstelle und vom Ministerium für Arbeit und Soziales geforderte zusätzliche Prüferpersonal entschieden werden.
4 Korruptionsverhütung
Die Arzneimittelinspekteure führen jährlich auf Antrag der Pharmaunternehmen Inspektionen bei Herstellern im Ausland durch, beispielsweise in Südostasien oder Amerika. Bisher haben die Pharmaunternehmen die komplette Abwicklung der hierzu erforderlichen Auslandsdienstreisen der Landesbediensteten übernommen und die Kosten unmittelbar getragen. Ein Nachweis des Reiseverlaufs, der Beförderungsmittel, der Unterbringungs- und der Verpflegungskosten wurde gegenüber dem Regierungspräsidium nicht erbracht.
Da die Kosten der Reise vom Auftraggeber zu tragen sind, mag eine solche Vorgehensweise zwar unbürokratisch erscheinen, sie kann jedoch so nicht fortgesetzt werden.
Für die Pharmaunternehmen wie auch für die ausländischen Hersteller ist das Testat über die Unbedenklichkeit der Produktionsstätten und -verfahren zur Herstellung von Arzneimitteln existenziell. Diese Konstellation gibt Anlass, der Gefahr unzulässiger Vorteilsgewährung zu begegnen. Schon der Anschein einer unzulässigen Vorteilsgewährung ist zu vermeiden.
Auch wenn sich das Regierungspräsidium bei Auslandsdienstreisen der Arzneimittelinspekteure von dem Auftraggeber, der die örtlichen Verhältnisse in der Regel besser kennt, unterstützen lässt, muss das Regierungspräsidium diese Aufgaben eigenverantwortlich wahrnehmen. Zur Vermeidung von Verstößen gegen gesetzliche Regelungen sollte das Regierungspräsidium die Dienstreisen genehmigen, die Reisekosten festsetzen und die Auszahlung über den Landeshaushalt anordnen. Dementsprechend sind die Auslagen für die Dienstreise im Gebührenbescheid auszuweisen und beim Auftraggeber zu erheben.
Außerdem empfiehlt die Finanzkontrolle, die Rotation der Arzneimittelinspekteure, ähnlich der Vorgehensweise bei Jahresabschlussprüfungen von landesbeteiligten Unternehmen, zu erwägen.
5 Gemeinsame Stellungnahme des Innenministeriums und des Ministeriums für Arbeit und Soziales
Das Innenministerium wendet sich gegen eine Übertragung von Stellen des gehobenen Dienstes auf das Regierungspräsidium Tübingen und verweist auf Personalkapazitäten im Umfang von 1,2 Vollzeitäquivalenten, welche bei den übrigen Regierungspräsidien dezentral für Verwaltungsaufgaben der Arzneimittelüberwachung zur Verfügung stünden. Nach Auffassung beider Ministerien ist es nicht gerechtfertigt, in die Gebührenrechnung sämtliche Aufwendungen der Leitstelle einfließen zu lassen, weil deren Aufgaben und Ziele auch dem Gesundheitsschutz der Bevölkerung dienten. Dennoch müsse ein höherer Kostendeckungsgrad erreicht werden. Das Ministerium für Arbeit und Soziales will zudem eine Gebührenanpassung zur besseren personellen Ausstattung der Leitstelle nutzen.
6 Schlussbemerkung
Die Finanzkontrolle bleibt bei ihrer Auffassung. Sie betont noch einmal, dass einer Personalverstärkung bei den Arzneimittelinspekteuren die Optimierung der bisherigen Strukturen vorausgehen muss.
Die Stellungnahme der beiden Ministerien zur Korruptionsverhütung ist sehr unverbindlich: Die Finanzkontrolle sieht hier Handlungsbedarf.
Der Brisanz des Themas wird nach Auffassung der Finanzkontrolle möglicherweise nur unzureichend Rechnung getragen. Das Regierungspräsidium Tübingen sollte das Verfahren eigenverantwortlich steuern und deshalb die Vorschläge der Finanzkontrolle umsetzen.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Die Heilfürsorge für Polizeibeamte bedarf im Zuge der Dienstrechtsreform einer neuen gesetzlichen Regelung. Wie in den anderen Bundesländern sollte dabei eine angemessene Eigenbeteiligung der Beamten an den Kosten der Heilfürsorge erwogen werden. Bei einer zehnprozentigen Eigenbeteiligung könnte der Landeshaushalt jährlich um 2 bis 3 Mio. € entlastet werden. Die Konzentration der Abrechnung der Heilfürsorge beim Landesamt für Besoldung und Versorgung hat sich bewährt. Allerdings muss das Abrechnungsverfahren auf der Grundlage neuer Vereinbarungen modernisiert und vereinfacht werden. Ein Systemwechsel von der Heilfürsorge zur Beihilfe brächte in Baden-Württemberg derzeit keine Einsparung.
1 Vorbemerkungen
Die Beamten des Landes erhalten im Falle der Krankheit Beihilfeleistungen, mit denen sich das Land anteilig (mit 50 % oder 70 %) an den notwendigen Behandlungskosten beteiligt.
Im Gegensatz dazu erhalten die (aktiven) Polizeibeamten des Landes bei Krankheit freie Heilfürsorge, d. h. das Land trägt die entstandenen Aufwendungen - von wenigen Ausnahmen abgesehen - zu 100 %. Rechtsgrundlage dafür sind die §§ 141 und 147 des Landesbeamtengesetzes und die vom Innenministerium erlassene Heilfürsorgeverordnung vom 21.04.1998.
Hintergrund dieser Regelung, die bis in die Neunzigerjahre in vergleichbarer Weise für die Polizeibeamten des Bundes und aller Bundesländer galt, ist die besondere Verantwortung des Dienstherrn für die Gesundheit der Polizeibeamten, die sich aus der Besonderheit des Polizeidienstes ergibt. Mittlerweile haben die meisten Bundesländer die freie Heilfürsorge abgeschafft und die Polizeibeamten an den Heilfürsorgeaufwendungen beteiligt oder in das System der Beihilfe integriert.
Für ihre Familienangehörigen erhalten die Polizeibeamten keine Heilfürsorge, sondern Beihilfeleistungen. Ebenfalls Beihilfeleistungen erhalten die Polizeibeamten im Ruhestand.
Im Unterschied zur Beihilfe, bei der der Beamte vorleistet und seine Aufwendungen gegenüber dem Land abrechnet, werden die Leistungen für Heilfürsorgeberechtigte von den kassenärztlichen Vereinigungen, den Abrechnungsstellen der Apotheker und den Krankenhäusern unmittelbar mit dem Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) abgerechnet. Grundlage dafür sind Vereinbarungen zwischen dem Land und den Leistungserbringern.
Im Jahre 2007 hatten insgesamt 25.165 Polizeibeamte Anspruch auf die Leistungen der Heilfürsorge. Die Ausgaben des Landes für die Heilfürsorge beliefen sich auf 38,57 Mio. €, dies entspricht Ausgaben von 1.533 € je anspruchsberechtigten Polizeibeamten.
Zuständig für die Abrechnung der Heilfürsorge waren bis 2005 die Heilfürsorgestellen der Bereitschaftspolizeidirektion und der fünf Landespolizeidirektionen. In den Jahren 2005 und 2006 wurde die Zuständigkeit sukzessive auf das LBV übergeleitet. Die im Einzelplan des Innenministeriums für die Abrechnung der Heilfürsorge vorhandenen Stellen wurden in den Einzelplan des Finanzministeriums übertragen.
Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Stuttgart hat - nach vollzogener Überleitung der Zuständigkeit auf das LBV - die Abrechnungspraxis der Heilfürsorge geprüft und dabei die folgenden Feststellungen getroffen.
2 Organisation und Verfahren
2.1 Konzentration beim Landesamt für Besoldung und Versorgung
Durch die Zusammenfassung der Zuständigkeit für die Abrechnung der Heilfürsorge beim LBV hat sich der Verwaltungsaufwand deutlich reduziert:
Waren bis 2005 insgesamt 26,8 Stellen für die Abrechnung der Heilfürsorge bei den befassten Dienststellen der Polizei vorgesehen, so werden seit November 2007 nur noch 18,5 Stellen für diese Aufgabe in Anspruch genommen. Nicht eingerechnet sind dabei allerdings Aufsichts- und Serviceleistungen der Querschnittseinheiten im LBV, die sich nicht im Einzelnen beziffern lassen.
Außerdem hat die Konzentration der Zuständigkeit beim LBV zu einer einheitlichen Verwaltungspraxis geführt, die das stark differierende Ausgabenverhalten der einzelnen Heilfürsorgestellen nivelliert hat. Konsequent wäre es, nunmehr auch die ministerielle Zuständigkeit für die Regelung der Heilfürsorge auf das Finanzministerium zu übertragen.
2.2 Rechtsgrundlagen
Die gesetzliche Grundlage der Heilfürsorge in den §§ 141 und 147 des Landesbeamtengesetzes entspricht nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Ausgestaltung einer Verordnungsermächtigung. Es bedarf daher im Zuge der anstehenden Dienstrechtsreform einer ausführlicheren Regelung im Gesetz, durch die die wesentlichen Rahmenbedingungen der Heilfürsorge normiert werden.
Außerdem wird in der Praxis noch immer die Verwaltungsvorschrift zur Heilfürsorgeverordnung aus dem Jahr 1998 angewendet, die zum 31.12.2005 außer Kraft getreten ist.
2.3 Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern
Nach wie vor unbefriedigend ist die technische Ausgestaltung der Abrechnung der im Rahmen der Heilfürsorge erbrachten Leistungen durch die (Zahn-)Ärzte und ihre Vereinigungen sowie die übrigen Leistungserbringer.
Die zugrunde liegenden Rahmenverträge sind teilweise mehr als 20 Jahre alt und müssen dringend an die veränderten Verhältnisse im Gesundheitswesen und die Möglichkeiten moderner Datentechnik angepasst werden.
2.3.1 Ärztliche Behandlungen und Medikamente
Die Polizeibeamten erhalten von ihrer Dienststelle für die ärztlichen und zahnärztlichen Behandlungen Behandlungsausweise, auf deren Grundlage die (Zahn-)Ärzte ihre Leistungen mit der kassen(zahn)ärztlichen Vereinigung abrechnen. Diese prüfen die Abrechnungen, stellen sie zusammen und reichen sie vierteljährlich beim LBV ein. Dort werden diese Sammelabrechnungen nicht noch einmal im Einzelnen überprüft.
Die Medikamente werden gesammelt durch zwei von den Apotheken eingeschaltete Unternehmen abgerechnet.
Der Rechnungshof schlägt vor, die Abrechnung künftig auf ein System beleglosen Datenaustausches umzustellen und den Polizeibeamten dafür maschinenlesbare Krankenversichertenkarten auszuhändigen.
2.3.2 Behandlungen im Krankenhaus
Die Krankenhäuser rechnen ihre Leistungen auf der Grundlage eines Kostenübernahmebescheids unmittelbar mit dem LBV ab.
Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt hat festgestellt, dass diese Abrechnungen bislang nicht mit derselben Sorgfalt überprüft werden wie Krankenhausabrechnungen im Rahmen des Beihilfeverfahrens, obwohl nach den Erfahrungen der Finanzkontrolle in diesem Bereich typischerweise Fehler auftreten.
Der Rechnungshof schlägt deshalb vor, die im Rahmen der Heilfürsorge anfallenden Krankenhausabrechnungen intensiver zu prüfen.
3 Ausgaben für die Heilfürsorge
3.1 Ist-Ausgaben
Die Ausgaben für die Heilfürsorge sind - wie alle Ausgaben im Gesundheitswesen - in den letzten Jahren stark angestiegen.
Die Entwicklung der Ausgaben von 2000 bis 2007 ergibt sich aus der Tabelle.
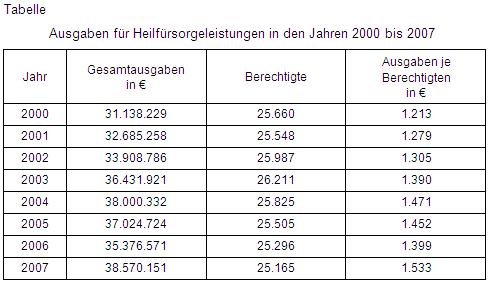
Trotz eines Rückgangs der Zahl der Heilfürsorgeberechtigten sind die Ausgaben im Zeitraum 2000 bis 2007 um 23,5 % gestiegen. Die Ausgaben je Berechtigten haben sich im selben Zeitraum um 26,4 % erhöht.
Gleichwohl liegen die Ausgaben je Berechtigten für die Heilfürsorge unter den Ausgaben, die das Land für seine aktiven Beamten im Bereich der Beihilfe leistet (2007: 1.923 € je aktiven Beamten).
Diese Differenz von 390 € ist verschiedenen Umständen geschuldet:
- Die Sätze, nach denen Heilfürsorgeleistungen abgerechnet werden, orientieren sich an den Vergütungssätzen der Ersatzkassen für vertragsärztliche Leistungen. Diese sind in der Regel geringer als die Sätze, die die Ärzte den beihilfeberechtigten Privatpatienten in Rechnung stellen (dürfen). Bei den Medikamenten gewähren die Apotheken dem Land einen Rabatt, den die beihilfeberechtigten Beamten nicht erhalten.
- Bei der Heilfürsorge gelten verschiedene Leistungseinschränkungen aus dem Recht der gesetzlichen Krankenversicherung, die das Beihilferecht bislang nicht übernommen hat (z. B. die Nichterstattung des Aufwands für nicht verschreibungspflichtige Medikamente).
- Die Heilfürsorgeberechtigten unterscheiden sich in maßgeblichen Merkmalen von den Beihilfeberechtigten. Dabei spielen der vergleichsweise geringe Frauenanteil, das niedrigere Durchschnittsalter und die besondere Altersgrenze bei Polizeibeamten sowie die Tatsache eine entscheidende Rolle, dass die Polizeibeamten nach ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit ausgewählt werden.
3.2 Möglichkeiten der Begrenzung der Ausgaben für die Heilfürsorge
Bereits in der Denkschrift 1994 hat der Rechnungshof verschiedene Kostendämpfungsvorschläge für die Heilfürsorge unterbreitet und dabei u. a. verschiedene Möglichkeiten der Eigenbeteiligung der Heilfürsorgeberechtigten an den durch Krankheit verursachten Kosten vorgeschlagen. Landtag und Landesregierung sind diesen Vorschlägen seinerzeit nur teilweise gefolgt.
Immerhin wurden in der Folgezeit eine Reihe von Leistungseinschränkungen aus dem Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung in das System der Heilfürsorge übernommen. Nach dem Vorbild der Beihilfe leisten diejenigen Polizeibeamten, die im Krankenhaus Wahlleistungen in Anspruch nehmen wollen, einen monatlichen Beitrag von 13 €.
Die zurückhaltende Reaktion der Landesregierung auf die Vorschläge des Rechnungshofs wurde seinerzeit im Wesentlichen damit begründet, dass auch die anderen Bundesländer keine Eigenbeteiligungen vorsehen und eine bundeseinheitliche Regelung geboten sei.
Mittlerweile gewähren nur noch die Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen allen aktiven Polizeibeamten uneingeschränkte Heilfürsorge. In Bayern, Rheinland-Pfalz und Thüringen ist die uneingeschränkte Heilfürsorge auf Polizeibeamte in der Ausbildung, bei Übungen und Einsätzen beschränkt.
Die Eigenbeteiligung an den Krankheitskosten erfolgt entweder durch die Integration der Polizeibeamten ins Beihilfesystem mit entsprechenden Kostendämpfungspauschalen (Bayern, Berlin, Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz, Thüringen), durch Anwendung der in der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehenen Zuzahlungen (Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Sachsen) oder durch eine pauschale Eigenbeteiligung in Höhe von 1,4 % des Grundgehalts (Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg) oder sogar 1,6 % des Grundgehalts (Niedersachsen).
Die Eigenbeteiligung schafft bei entsprechender Ausgestaltung neben dem unmittelbaren Einspareffekt ein wirtschaftliches Interesse des Beamten an einer sparsamen Inanspruchnahme der angebotenen Heilfürsorgeleistungen.
Der Rechnungshof regt deshalb an, im Zuge der Novellierung des Landesbeamtengesetzes und der Heilfürsorgeverordnung eine Eigenbeteiligung der Polizeibeamten an den Kosten der Heilfürsorge zu erwägen.
Bei einer Eigenbeteiligung in Höhe von 10 % der auf den jeweiligen Beamten entfallenden Heilfürsorgeaufwendungen würde sich ein Einsparpotenzial für das Land in Höhe von 2 bis 3 Mio. € jährlich ergeben. Um die finanzielle Belastung des einzelnen Beamten in Grenzen zu halten, könnte ein Höchstbetrag für die Eigenbeteiligung (z. B. 400 € jährlich) vorgesehen werden, der etwa der Höhe der Prämie entspricht, die bei einer privaten Krankenversicherung für die Absicherung von 10 % der Krankheitskosten fällig wäre. Die Besserstellung der aktiven Polizeibeamten gegenüber den beihilfeberechtigten Beamten (90 % statt 50 bis 70 % Kostenerstattung) bliebe bei dieser Regelung erhalten.
3.3 Überführung der Heilfürsorge in das System der Beihilfe
Der in mehreren anderen Bundesländern vollzogene Systemwechsel von der freien Heilfürsorge zur Beihilfe für aktive Polizeibeamte bzw. neu eingestellte aktive Polizeibeamte empfiehlt sich für das Land Baden-Württemberg nicht.
Aufgrund der in Baden-Württemberg geltenden Beihilferegelungen würde ein solcher Systemwechsel voraussichtlich nicht zu einer Einsparung, sondern zu Mehrausgaben führen.
4 Stellungnahme der Ministerien
Das Finanzministerium erhebt keine grundsätzlichen Einwendungen, wendet sich aber in seiner Stellungnahme gegen die Feststellung, die Krankenhausabrechnungen würden nicht intensiv geprüft. Vielmehr erfolge im Rahmen des Möglichen eine Plausibilitätsprüfung.
Weiterhin stellt das Finanzministerium die vom Rechnungshof genannten Beihilfeausgaben je aktiven Beamten infrage.
Schließlich wendet sich das Finanzministerium gegen den Vorschlag, eine prozentuale Beteiligung des Polizeibeamten an seinen Heilfürsorgeaufwendungen vorzusehen, da dies mit unverhältnismäßig großem Verwaltungsaufwand verbunden sei und erstmals eine individuelle Zurechnung der Heilfürsorgeausgaben notwendig machen würde. Eine nach der Höhe des Grundgehalts bemessene Beteiligung des Beamten an den Heilfürsorgeaufwendungen komme deshalb aus der Sicht des Ministeriums eher in Betracht als die vom Rechnungshof vorgeschlagene Lösung. Auch die Frage der Integration der heilfürsorgeberechtigten Beamten in das System der Beihilfe müsse ergebnisoffen geprüft werden.
Das Innenministerium erhebt keine Einwände gegen die Sachdarstellung und die Vorschläge des Rechnungshofs. Es wendet sich jedoch gegen die vom Finanzministerium in die Diskussion gebrachte nach der Höhe des Grundgehalts bemessene Beteiligung der Beamten an den Heilfürsorgeaufwendungen.
5 Schlussbemerkung
Der Rechnungshof bleibt bei seiner Empfehlung, dass die Krankenhausabrechnungen im Rahmen der Heilfürsorge intensiver geprüft werden müssen. Die vom Finanzministerium genannte Prüfungstiefe trägt der wirtschaftlichen Bedeutung dieser Kostengruppe nicht ausreichend Rechnung.
Die vom Rechnungshof genannten Zahlen beruhen auf Ergebnissen des LBV und sind korrekt. Würden die vom Finanzministerium in seinen Statistiken genannten Zahlen eingesetzt, ergäbe sich eine noch größere Differenz zwischen den Heilfürsorgeaufwendungen und den Aufwendungen für die Beihilfe.
Vor diesem Hintergrund bleibt der Rechnungshof bei seiner Auffassung, dass ein Systemwechsel zur Beihilfe gegenwärtig keine Einsparung brächte.
Richtig ist, dass das vom Rechnungshof vorgeschlagene Modell der Eigenbeteiligung einen höheren Verwaltungsaufwand verursacht als eine nach der Höhe des Gehalts bemessene pauschale Eigenbeteiligung der Polizeibeamten. Dieser Verwaltungsaufwand wäre jedoch bei Einsatz einer maschinenlesbaren Krankenversichertenkarte überschaubar und würde zugleich eine kostendämpfende Wirkung entfalten, die den Verwaltungsaufwand kompensiert.
Andererseits trägt auch die vom Finanzministerium in Betracht gezogene und in einigen anderen Bundesländern realisierte Form der Eigenbeteiligung den Bedenken des Rechnungshofs gegen das heutige System Rechnung und könnte zu einer vergleichbaren Entlastung des Landeshaushalts führen wie der Vorschlag des Rechnungshofs.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Bei der Förderung von Brückenausbauten im kommunalen Straßenbau wurden bislang die Aspekte der vernachlässigten Unterhaltung nicht berücksichtigt. Verkehrliche Nachweise fehlten häufig. Dies führte in vielen Fällen zu überdimensionierten Bauwerken. Die künftigen Förderregelungen müssen dem entgegenwirken.
1 Vorbemerkung
Die Beanspruchung von Straßen und der zugehörigen Ingenieurbauwerke, wie Brücken und Tunnel, ist durch den stark gestiegenen Verkehr und die immer schwereren Fahrzeuge im Güterverkehr gewachsen.
In Baden-Württemberg gibt es rd. 10.000 Brücken an Kreis- und Gemeindeverbindungsstraßen, die in der Mehrzahl zwischen 1965 und 1985 gebaut wurden. Angesichts der Nutzungsdauer der Bauwerke stehen die für die kommunalen Straßen unterhaltungspflichtigen Gemeinden einem wachsenden baulichen Erhaltungsbedarf (Instandhaltung, Instandsetzung, Erneuerung) gegenüber, der über eigene Mittel abzudecken ist.
Die Förderung der kommunalen Verkehrsanlagen steht mit dem Außerkrafttreten des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes zum 31.12.2006 vor einem Umbruch. Bisher standen nach diesem Gesetz Fördermittel mit einer Förderquote von bis zu 70 % der zuwendungsfähigen Ausgaben für Neu- und Ausbau sowie für Erweiterungen, die der Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Bauwerks dienen, zur Verfügung. Im Falle von Brücken sind danach förderfähig:
- Überbauerneuerungen und Verbreiterungen zwischen den Geländern zur Aufnahme zusätzlicher Fahrstreifen oder von Geh- und Radwegen sowie
- Tragfähigkeitserhöhungen gegenüber der ursprünglichen Bemessung.
Das Innenministerium wird im Einvernehmen mit dem Finanzministerium bis Ende 2008 eine Nachfolgeregelung erarbeiten, welche die durch bundesgesetzliche Vorgaben auferlegten engen finanziellen Spielräume berücksichtigt. Fördermittel werden auch künftig eine wichtige Säule der Finanzierung kommunaler Verkehrsinfrastruktur sein. Der Rechnungshof und die staatlichen Rechnungsprüfungsämter haben im Hinblick auf die künftige Förderpraxis nach dem Zufallsprinzip 27 Vorhaben mit einem Fördervolumen von 23 Mio. € landesweit ausgewählt und geprüft.
2 Förderfähigkeit der geprüften Vorhaben nach dem bisherigen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
Die geprüften Bauwerke erfüllen formal die Fördervoraussetzungen, nämlich Erhöhung der Brückentragfähigkeit bzw. Verbesserung des Verkehrsablaufs. Ursächlich für eine kapazitive Erweiterung können aber sowohl steigende Verkehrsmengen als auch kritische Bauwerkszustände sein, welche die Nutzung einer Brücke einschränken.
Die Fördersystematik differenziert aber nicht, ob eine vernachlässigte Bauwerksunterhaltung oder andere Einflüsse (u. a. zunehmende Verkehrsbelastung, Alter des Bauwerks) vorliegen. Die Förderfähigkeit wurde deshalb in diesen Fällen stets als gegeben betrachtet.
3 Vernachlässigte Unterhaltung der Bauwerke
Der Unterhaltungspflichtige hat das Bauwerk funktionsfähig zu erhalten und eventuell eingetretene Mängel und Schäden am Bauwerk rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen. Hierdurch sollen der Bestand und die Verkehrssicherheit des Bauwerks gewährleistet und eine vorzeitige Erneuerung vermieden werden.
Die Überwachung und Prüfung erfolgt nach der DIN 1076 „Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen“, die alle sechs Jahre Hauptprüfungen, alle drei Jahre einfache Prüfungen und jährlich Besichtigungen sowie laufende Beobachtungen vorgibt. Wesentliche Unterlage ist das Brückenbuch, in dem neben den wichtigsten technischen Daten zum Bauwerk auch die durchgeführten Prüfungen und die zur Behebung von Mängeln oder Schäden ausgeführten baulichen Erhaltungsmaßnahmen zu dokumentieren sind.
Die Prüfung des Rechnungshofs ergab, dass nur für 13 der 27 geprüften Vorhaben Brückenbücher vorlagen. Für die übrigen Brücken war nach Angaben der Baulastträger nie ein Brückenbuch geführt worden. Auch wurden die Brückenbücher bei keinem der geprüften Vorhaben ordnungsgemäß geführt, da nur die Protokolle der Hauptuntersuchungen aufgeführt waren. Die Prüfprotokolle der anderen Prüfungen und der jährlichen Besichtigungen fehlten ebenso wie Angaben zu den durchgeführten Instandsetzungsarbeiten.
Weiterhin wurde festgestellt, dass größtenteils nur die vorgeschriebenen Hauptprüfungen durchgeführt wurden, einfache Prüfungen hingegen deutlich seltener waren und sich in der Regel auf Brücken mit höherem Verkehrsaufkommen beschränkten. Die gesichteten Protokolle der Hauptuntersuchungen zeigten ferner, dass zwar Schadensbilder (Stand- und Verkehrssicherheit, Dauerhaftigkeit) genannt, aber keine konkreten Zeitvorgaben zur Schadensbehebung gemacht wurden.
Die oftmals identischen, sich über mehrere Zyklen der Hauptprüfungen hinweg stetig verschlechternden Schadensbilder belegen, dass die festgestellten Mängel und Schäden häufig nicht beseitigt wurden. Dies führte dazu, dass letztlich wegen inzwischen sehr starker Beschädigungen eine Grunderneuerung oder ein Ersatzneubau der Brücke empfohlen werden musste. Lediglich bei einem Vorhaben wurde festgestellt, dass im Laufe der letzten Jahre in größerem Umfang eine bauliche Erhaltung stattfand, die dazu diente, eine Reduzierung der Tragfähigkeit zu verzögern.
Angesichts der festgestellten vernachlässigten baulichen Erhaltung verkürzte sich in der Regel die theoretische Nutzungsdauer der Bauwerke; der Erfahrungswert für die mögliche Dauer der Nutzung bewegt sich für den Unterbau bei rd. 110 Jahren, für den Überbau bei 70 bis 80 Jahren. So ergab sich anhand der Baujahre der Brücken und der Daten für die Bewilligungen, dass zumindest für ein Drittel der geprüften Brücken eine vorzeitige „Wiederherstellung“ des Bauwerks vorlag. Lediglich in Einzelfällen machten Materialprobleme oder andere Einflüsse (z. B. Spätfolgen von Kriegsschäden mit Notreparaturen) das Ersatzbauwerk erforderlich (siehe Tabelle 1).
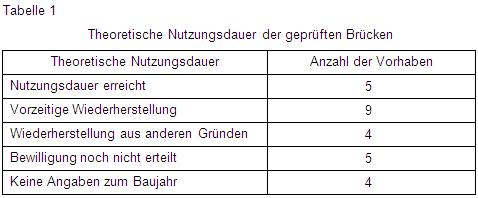
4 Baulicher Zustand der geprüften Brückenbauwerke
Nachdem an den geprüften Bauwerken meist über Jahre keine ausreichenden Unterhaltungsarbeiten oder baulichen Erhaltungen durchgeführt wurden, befanden sie sich in einem schlechten (befriedigend bis noch ausreichend) oder gar in einem kritischen bzw. ungenügenden Bauwerkszustand (siehe Tabelle 2); dieser wird auf Veranlassung des Baulastträgers von einem sachkundigen Ingenieur beurteilt.
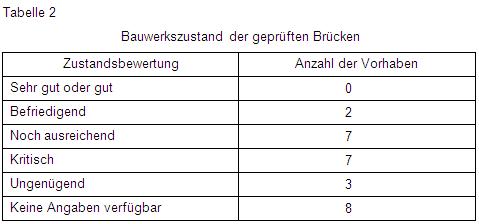
Infolge des schlechten Bauwerkszustands erfüllten die Brücken in weiten Teilen nur noch eingeschränkt ihre Funktion. So war bei etwa der Hälfte der geprüften Bauwerke die zugelassene Tragfähigkeit gegenüber der Traglast bei Inbetriebnahme im Laufe der Zeit aus Verkehrssicherheitsgründen herabgesetzt worden. Die Absenkung der ursprünglichen Traglast reichte von 4 t bis 29 t, prozentual von 20 % bis über 75 %.
5 Prognostizierte Verkehrsaufkommen
Eine wesentliche Grundlage für die Förderung stellt der verkehrliche Bedarf dar, der durch aktuelle Zählungen und Prognosen nachzuweisen ist.
Die Prüfung ergab, dass bei der Antragstellung fast immer auf hohe oder steigende Verkehrsmengen hingewiesen wurde, in mehreren Fällen aber keine Unterlagen über Verkehrszählungen beigefügt waren. Außerdem prognostizierten die vorliegenden Gutachten hohe, teilweise nicht nachvollziehbare Verkehrsaufkommen, welche die „notwendige Traglasterhöhung“, also die förderfähige kapazitive Erweiterung eines Brückenbauwerks, untermauerten.
Die hohen Verkehrsprognosen führten dazu, dass die neu zu bauenden bzw. zu erweiternden Brücken entsprechend dimensioniert wurden. So wurden bei allen geprüften Vorhaben die Brücken vergrößert, damit sie dem - tatsächlich oder nur per Prognose ermittelten - erhöhten Verkehrsaufkommen entsprechen. Beispielsweise wurden gegenüber den Vorgängerbrücken erhöht
- die Brückenflächen um 60 % bis 188 %,
- die Gesamtbreiten um 17 % bis 101 % und
- die Fahrbahnbreiten um 4 % bis 62 %.
Außerdem wurde bei allen geprüften Bauwerken generell die Tragfähigkeit auf 60 t festgelegt, obgleich nur eines der geprüften Vorhaben bereits eine Traglast von 60 t auswies. Die übrigen Brücken hatten eine Tragfähigkeit von unter 45 t, bei 6 davon lag sie sogar unter 10 t.
Die Bewilligungsstellen erwogen vor diesem Hintergrund nicht, ob die eventuelle Verstärkung zur Wiederherstellung der ursprünglichen Tragfähigkeit eine wirtschaftlichere Lösung dargestellt hätte.
6 Dimensionierung, Standards und Bauausgaben der neuen Brücken
Die Auswertungen zeigen, dass bei der Erneuerung von Brücken fast immer der oberste technische Standard herangezogen wurde. So weist die Hälfte der geprüften Vorhaben Ausgaben von mehr als 2.200 €/m² Brückenfläche auf. Ausgaben in dieser Größenordnung sind für den Neubau von Brücken üblich.
Ob ein reduzierter Standard (z. B. einbahnige Führung, Verringerung der Fahrbahnbreite, Tragfähigkeit 30 t oder 45 t) unter kritischer Betrachtung der Bedeutung der Straße und der Verkehrsbelastung möglich gewesen wäre, wurde nicht geprüft.
7 Empfehlungen
Der Rechnungshof empfiehlt, die nachfolgenden Punkte in die Nachfolgeregelung zum Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz aufzunehmen.
7.1 Erhaltungsmanagement
In Anbetracht der angetroffenen Fälle mangelnder Überwachung und Prüfung sowie der unzureichenden baulichen Erhaltung der Brückenbauwerke, die häufig zu vorzeitigen und kostenintensiven Grunderneuerungen bzw. einer kapazitiven Erweiterung des Brückenbauwerks führten, wird empfohlen, die Antragsteller ihre kontinuierlich zu leistenden Erhaltungsarbeiten für einen festzulegenden Zeitraum nachweisen zu lassen. Bei fehlendem Nachweis wird empfohlen, einen Abzug von der Förderung vorzunehmen, der sich nach dem jährlich erforderlichen Mindestbetrag für die bauliche Erhaltung bemisst.
7.2 Bedarfsorientierter Aus- und Neubau
Voraussetzung für die Förderung nach dem bisherigen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz war stets, dass das Bauvorhaben dringend notwendig ist, um die Verkehrsverhältnisse in der Gemeinde zu verbessern. In diesem Sinne sollten die Antragsteller künftig beim Aus- und Neubau darlegen, welche Gründe maßgebend für eine Höherdimensionierung der Brücke sind und ob die Aufwendungen der Verkehrsbedeutung der Straße entsprechen. Hierzu sollten in den Antragsunterlagen aktuelle Verkehrsgutachten enthalten sein, aus denen die derzeitige und die künftige Verkehrssituation hervorgeht. Im Weiteren sollte der Antragsteller darlegen, dass dem ermittelten verkehrlichen Bedarf nur durch Aus- und Neubaumaßnahmen, nicht aber durch bauliche Erhaltung, begegnet werden kann.
7.3 Anwendung von Festbetragsfinanzierungen und Förderhöchstbeträgen
Zur Vereinfachung des Zuwendungsverfahrens und letztlich auch zur Überprüfung der Plausibilität von Kostenansätzen sollten vermehrt Festbetragsfinanzierungen gewählt werden. Der Umfang der Festbetragsfinanzierung kann sich an Förderhöchstbeträgen oder Pauschalen orientieren. Die entsprechenden Größen können bei Brückenbauwerken sowohl bei Erneuerungen als auch bei Neu- und Ausbauten nach der Brückenfläche bemessen werden.
8 Stellungnahme des Ministeriums
Das Innenministerium erhebt keine grundsätzlichen Einwände gegen die Ausführungen des Rechnungshofs. Das Ministerium sagt zu, die Empfehlungen in die Überlegungen zur Nachfolgeregelung zum Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz einzubeziehen.
9 Schlussbemerkung
Die Förderung von Brückenbauwerken sollte sich eindeutig am ermittelten verkehrlichen Bedarf ausrichten und die Vorhabensträger nicht zu Überdimensionierungen veranlassen. So kann für das Land als Zuwendungsgeber und für die Kommunen als Vorhabensträger ein wirtschaftlicherer Einsatz der knappen Fördermittel erreicht werden.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Die vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern ist aufgrund rückläufiger Zugangszahlen in ihrer derzeitigen Form nicht mehr wirtschaftlich. Das Land sollte bei der Anpassung der Ausgabenerstattung berücksichtigen, dass Stadt- und Landkreise die Aufgabe auch gemeinsam wahrnehmen können.
1 Ausgangslage
Seit dem 01.04.2004 erstattet das Land den Stadt- und Landkreisen auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz die Ausgaben für die im Rahmen der vorläufigen Unterbringung nach dem Asylverfahrensgesetz aufzunehmenden Personen durch eine einmalige Gesamtpauschale für jede zugeteilte und übernommene Person.
Mit dieser Pauschale in Höhe von zunächst 7.845 €/Person werden notwendige Ausgaben für personellen und sächlichen Verwaltungsaufwand zur Durchführung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes, für Beratung und Betreuung, für Krankenhilfeleistungen, für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und dem Bundessozialhilfegesetz, für liegenschaftsbezogene Ausgaben der Stadt- und Landkreise sowie für Kosten der Gemeinden im Rahmen der Anschlussunterbringung erstattet.
Die Pauschale erhöht sich jährlich um 1 % und betrug im Jahr 2007 somit 8.083 €.
2 Prüfungsanlass und Prüfungsziel
Das Flüchtlingsaufnahmegesetz sieht in § 9 Abs. 6 vor, dass das Innenministerium die Pauschale durch Rechtsverordnung jeweils zum 1. Januar eines Jahres neu festsetzen kann, wenn und soweit dies aufgrund einer Überprüfung der tatsächlichen Aufwendungen erforderlich ist. Zu diesem Zweck hat sich das Innenministerium im Jahr 2006 von den Stadt- und Landkreisen über die in den ersten zwei Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes angefallenen Ausgaben berichten lassen. Die für den Erhebungszeitraum vom 01.04.2004 bis 31.03.2006 gemeldeten Ausgaben bildeten jedoch noch keine ausreichend aussagekräftige Grundlage für eine Anpassung der Pauschalen.
Die staatlichen Rechnungsprüfungsämter Stuttgart und Tübingen haben ergänzende örtliche Erhebungen bei 14 Stadt- und Landkreisen mit dem Ziel durchgeführt, die gemeldeten Zahlen zu überprüfen, belastbare Aussagen zur Auskömmlichkeit der Ausgabenerstattung des Landes zu treffen und Wirtschaftlichkeitspotenziale bei der Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber durch die Stadt- und Landkreise aufzuzeigen.
3 Feststellungen
Die Prüfung hat ergeben, dass die der Pauschale nach § 9 Abs. 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz vom Innenministerium zugrunde gelegten Ausgaben und die geschätzte durchschnittliche Verweildauer in der vorläufigen Unterbringung von 20 Monaten aus damaliger Sicht sachgerecht waren.
Seit der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes im Jahr 2004 haben sich jedoch vor allem die Zugangszahlen und die Verweildauer der Asylbewerber derart verändert, dass Anpassungen bei der pauschalen Ausgabenerstattung notwendig werden.
3.1 Entwicklung der Asylbewerberzahlen in Baden-Württemberg
Wie die Abbildung zeigt, ist die Zahl der Asylbewerber seit dem Jahr 2002 um mehr als 80 % gesunken.

Es ist davon auszugehen, dass bei jährlich rd. 1.600 neuen Asylsuchenden eine gewisse Untergrenze erreicht ist. Vorsichtigerweise rechnet das Innenministerium bei seinen Planungen mit jährlich 2.000 Personen.
3.2 Entwicklung der Verweildauer in der vorläufigen Unterbringung
Die Verweildauer in der vorläufigen Unterbringung beträgt derzeit durchschnittlich 32 Monate. Davon entfallen 18 Monate auf das Asylverfahren; die übrigen 14 Monate betreffen die Zeit nach der bestandskräftigen Ablehnung des Asylantrags.
Während die durchschnittliche Dauer der Asylverfahren in Baden-Württemberg in den letzten Jahren durchweg bei rd. 20 Monaten lag (rd. 2 Monate davon verbringt ein Asylbewerber in der Landesaufnahmestelle in Karlsruhe), ist die Verweildauer nach Abschluss des Asylverfahrens deutlich angestiegen. Zu Beginn des Jahres 2004 hatte das Innenministerium bei seinen Berechnungen noch einen Zeitraum von fünf Monaten zugrunde gelegt; zurzeit beträgt dieser im Durchschnitt schon 14 Monate.
Die Gründe für die längere Verweildauer liegen zum einen in einer Gesetzesänderung. So kann seit der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes im Jahr 2004 das bislang auf maximal 12 Monate nach Abschluss des Asylverfahrens begrenzte Nutzungsverhältnis für die Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft nach § 7 Abs. 5 Flüchtlingsaufnahmegesetz ausnahmsweise verlängert werden, wenn die begründete Aussicht besteht, dass der Aufenthalt der betreffenden Person in absehbarer Zeit beendet werden kann. Das gleiche gilt, wenn der Aufenthalt aus Gründen nicht beendet werden kann, welche die vorläufig untergebrachte Person zu vertreten hat (z. B. Nichtmitwirkung bei der Passbeschaffung).
Die längere Verweildauer in Gemeinschaftsunterkünften ist aber auch auf folgenden Umstand zurückzuführen: Den Stadt- und Landkreisen war es bisher nicht möglich, dem Rückgang der Asylbewerberzahlen mit einem entsprechenden Abbau von Unterkünften zu folgen, woraus hohe Leerstände resultieren. Der wegen mangelnder Kapazitäten noch vor Jahren existierende Druck, die vorläufig untergebrachten Personen zügig in die kommunale Anschlussunterbringung zu überführen, fehlt deshalb mittlerweile. Zudem ist die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften in der Regel kostengünstiger als die Anschlussunterbringung.
3.3 Bedarf an Unterbringungskapazitäten
Mit den drastisch gesunkenen Zugangszahlen ist auch der Bedarf an Unterbringungsplätzen für die Asylbewerber deutlich zurückgegangen. Die Tabelle zeigt die Entwicklung der von der Landesaufnahmestelle für die Erstaufnahme und von den Stadt- und Landkreisen für die vorläufige Unterbringung insgesamt vorgehaltenen Plätze, deren Belegung und den Leerstand.
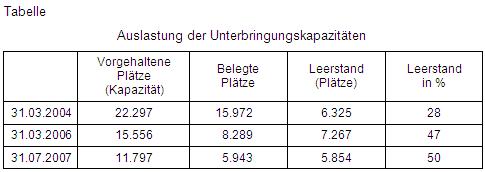
Bei Zugangszahlen von höchstens 2.000 Personen je Jahr, einer Aufenthaltsdauer von 32 Monaten und unter Berücksichtigung einer Reserve von 10 % ergibt sich ein Bedarf von 6.000 Unterbringungsplätzen, welche von den Stadt- und Landkreisen vorzuhalten sind. Hinzu kommen 500 Plätze in der Erstaufnahme.
Somit sind vom obigen Bestand rd. 5.500 Plätze verzichtbar. Diese Überkapazitäten sollten zügig abgebaut werden.
3.4 Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit der vorläufigen Unterbringung
Bei Zugängen von jährlich 2.000 Personen und einer Verweildauer in vorläufiger Unterbringung von 32 Monaten sind künftig nur noch 5.300 Asylbewerber von den 43 Stadt- und Landkreisen in Gemeinschaftsunterkünften unterzubringen. Dies bedeutet im Durchschnitt lediglich 120 Personen je Stadt- oder Landkreis. Der Betrieb von Unterkünften lässt sich bei einer solchen kleinteiligen Unterbringungsstruktur auf Dauer aber nicht mehr wirtschaftlich bewerkstelligen. Das hat sich ganz deutlich bei einigen kleineren Stadt- und Landkreisen gezeigt, welche weniger als 100 Personen unterzubringen haben.
Rückschlüsse auf die richtige Größe von Unterbringungseinrichtungen lassen sich hingegen aus den Zahlen der Stadt- und Landkreise ziehen, welche im Erhebungszeitraum noch über vergleichsweise kostengünstige Strukturen verfügten. Hiernach müssten je Stadt- oder Landkreis etwa 400 bis 800 Plätze vorgehalten und diese zu rd. 80 % ausgelastet werden, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten. Dies wurde von mehreren Stadt- und Landkreisen bestätigt.
Das Land sollte deshalb in den Verhandlungen über eine Anpassung der pauschalen Ausgabenerstattung besonders darauf achten, dass kommunale Kooperationen gemäß § 13 a Landesverwaltungsgesetz mit dem Ziel zustande kommen, größere, gemeinsam betriebene Unterbringungseinheiten auf Kreisebene zu schaffen. Der Grundsatz, die dem Land zugewiesenen Asylbewerber auf alle Stadt- und Landkreise zu verteilen, bliebe davon unberührt.
3.5 Ausgaben für die vorläufige Unterbringung
Die Erhebungen für den Zeitraum vom 01.04.2004 bis 31.03.2006 lassen den Schluss zu, dass die damaligen Berechnungen des Innenministeriums zur Ermittlung der Pauschale im Wesentlichen zutreffend waren. Ein Vergleich zwischen Erstattungspauschale und tatsächlichen Ausgaben der Stadt- und Landkreise - bezogen auf den Zeitraum eines Jahres - zeigt, dass je vorläufig untergebrachter Person per saldo Mehrausgaben von durchschnittlich 331 € (6 %) anfielen. Kostenunterdeckungen beruhten im Wesentlichen darauf, dass die Stadt- und Landkreise im Liegenschafts- und Personalbereich noch nicht angemessen auf die rückläufigen Unterbringungszahlen reagiert haben.
Ein ganz anderes Bild in Bezug auf die Auskömmlichkeit der Erstattungsleistungen des Landes ergibt sich freilich, wenn die aktuelle Verweildauer von 32 Monaten in der vorläufigen Unterbringung (davon 18 Monate im Status Asylbewerber) und die bestehenden Überkapazitäten in die Betrachtung einbezogen werden. Dann ergeben sich deutlich höhere Ausgaben der Stadt- und Landkreise, die überschlägig berechnet bis zu 12.500 € je Asylbewerber betragen könnten.
3.6 Einsparmöglichkeiten
In den derzeitigen Ausgaben der Stadt- und Landkreise steckt allerdings erhebliches Einsparpotenzial (Abbau von Leerständen, Anpassung des Verwaltungs- und Betreuungspersonals an die gesunkenen Asylbewerberzahlen, Einnahmeoptimierung, Optimierung der Unterbringungsstrukturen usw.). Es ist dem Land nicht zuzumuten, dass es unwirtschaftliche Strukturen der Stadt- und Landkreise, die alle in den Durchschnittsbetrag mit eingeflossen sind, finanziell abgilt. Maßgeblich für den als „entstanden“ abzugeltenden Aufwand können deshalb nur diejenigen Ausgaben sein, die für die Aufgabenerfüllung bei pauschalierender und typisierender Betrachtungsweise unter dem Blickwinkel der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit objektiv erforderlich sind.
Abhängig vom jeweiligen Grad der Ausschöpfung der Einsparpotenziale wären nach verschiedenen Modellberechnungen der Finanzkontrolle Pauschalen von maximal 10.800 € und günstigstenfalls von 10.000 € je zugewiesener Person ausreichend, um die derzeitigen Ausgaben der Stadt- und Landkreise zu decken. Die Pauschale je Asylbewerber fiele allerdings noch geringer aus, wenn für deren Berechnung beispielsweise die gesetzliche Regelverweildauer gemäß § 7 Abs. 5 Satz 1 Flüchtlingsaufnahmegesetz in Höhe von 12 Monaten zugrunde gelegt wird.
4 Stellungnahme des Ministeriums
Das Innenministerium hat gegen die Darstellung der Finanzkontrolle keine Einwendungen.
5 Schlussbemerkung und Resümee
Das Land sollte die Verhandlungen über die Höhe der künftigen Ausgabenerstattung an die Stadt- und Landkreise nutzen, um auf die Ausschöpfung möglichst hoher Einsparpotenziale bei der vorläufigen Unterbringung von Asylbewerbern hinzuwirken. Die Möglichkeit für die Stadt- und Landkreise, diese Aufgabe auch gemeinsam zu erfüllen, sollte dabei besonders betont werden.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Einzelplan 04: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Pädagogische Tage der Lehrkräfte an allgemein bildenden Schulen wurden entgegen den Leitlinien des Kultusministeriums überwiegend während der Unterrichtszeit veranstaltet. Dadurch fielen allein im Schuljahr 2006/07 an den untersuchten Schulen mehr als 18.000 Unterrichtsstunden aus. Die Pädagogischen Tage sollten so organisiert werden, dass möglichst wenig Unterricht ausfällt.
1 Ausgangslage
Nach den Leitlinien des Kultusministeriums stellen die Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung zentrale Instrumente für die Unterrichts-, Schul- und Personalentwicklung im Rahmen eines umfassenden schulischen Qualitätskonzepts dar. Danach bilden schulinterne Maßnahmen einen Schwerpunkt der Lehrerfortbildung, wozu auch die sogenannten Pädagogischen Tage gehören. Pädagogische Tage sind dienstliche Veranstaltungen, an denen alle Lehrkräfte der Schule teilnehmen und die grundsätzlich in der unterrichtsfreien Zeit durchzuführen sind. Ausnahmsweise darf jedoch, je nach Art und Inhalt der schulinternen Fortbildungsveranstaltung, Unterrichtszeit in Anspruch genommen werden.
Die staatlichen Rechnungsprüfungsämter untersuchten landesweit die Durchführung von Pädagogischen Tagen an ausgewählten allgemein bildenden Schulen. In die Untersuchung waren insgesamt 718 Grund- und Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien einbezogen, was einer Quote von 21 % entsprach. Der Untersuchungszeitraum umfasste die Schuljahre 2004/05, 2005/06 und 2006/07.
2 Feststellungen
In den beiden Schuljahren 2004/05 und 2005/06 führten jeweils 70 % der untersuchten Schulen Pädagogische Tage durch. Im Schuljahr 2006/07 waren es lediglich 56 %.
Ein Teil der untersuchten Schulen führte diese Veranstaltungen außerhalb der Unterrichtszeit, z. B. an Wochenenden, in der ersten oder letzten Ferienwoche, an Nachmittagen oder an sonstigen schulfreien Tagen, durch und vermied Unterrichtsausfall. Landesweit waren dies 12 % der untersuchten Schulen im Schuljahr 2004/05, 19 % im Schuljahr 2005/06 und bereits 48 % im Schuljahr 2006/07.
Beim Großteil der untersuchten Schulen fanden die Pädagogischen Tage jedoch unter Inanspruchnahme von Unterrichtszeit statt, wie die Tabelle, getrennt nach Schularten und Schuljahren, darstellt.
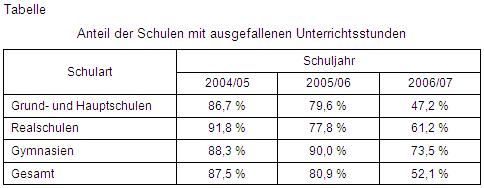
Noch im Schuljahr 2006/07 führten die Pädagogischen Tage an 52 % der Schulen zu Unterrichtsausfall. Dabei fallen die hohen Werte für die Schularten Realschule und Gymnasium auf.
Der durch Pädagogische Tage verursachte Unterrichtsausfall belief sich im Untersuchungszeitraum auf insgesamt mehr als 85.000 Unterrichtsstunden. Allein im Schuljahr 2006/07 fielen an den untersuchten Schulen insgesamt 18.000 Unterrichtsstunden aus.
3 Bewertungen und Empfehlungen
Zur Durchführung von Pädagogischen Tagen besteht für die Schulen zwar keine Verpflichtung; gleichwohl sind diese Veranstaltungen ein Schwerpunkt der Lehrerfortbildung im Rahmen eines umfassenden schulischen Qualitätskonzepts.
Die Mehrzahl der überprüften Schulen, unter ihnen besonders viele Gymnasien und Realschulen, kam allerdings dem Grundsatz, Pädagogische Tage während der unterrichtsfreien Zeit zu veranstalten, auch im Schuljahr 2006/07 noch nicht nach. Die in den Leitlinien des Kultusministeriums zugelassene Ausnahme stellte eher die Regel dar. Der Anteil der Schulen, die die Ausnahmebestimmung in Anspruch nahmen, ist zu hoch. Die dadurch im Schuljahr 2006/07 ausgefallenen 18.000 Unterrichtsstunden entsprechen rd. 19 Lehrervollzeitäquivalenten mit einem rechnerischen Gegenwert von 1 Mio. €. Das Ministerium sollte steuernd eingreifen.
4 Stellungnahme des Ministeriums
Das Kultusministerium hat gegen die Darstellung der Finanzkontrolle keine Einwendungen erhoben.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Das Land hat bisher darauf verzichtet, die Kosten für tagesstrukturierende Angebote in seinen Heimsonderschulen bei den zuständigen Kostenträgern einzufordern. Hierdurch entsteht dem Land ein Einnahmeausfall von jährlich rd. 7 Mio. €.
1 Prüfungsgegenstand
Für Schüler mit einem spezifischen sonderpädagogischen Förderbedarf unterhält das Land acht Staatliche Heimsonderschulen. Etatisiert wurden hierfür im Jahr 2006 bei Kapitel 0408 rd. 54 Mio. €. Im Schuljahr 2006/07 besuchten rd. 1.800 Schüler diese Einrichtungen; davon waren etwa zwei Drittel (1.233) externe Schüler.
Als Träger der Heimsonderschulen finanziert das Land zunächst die gesamten Kosten dieser Schulen, sowohl die des Unterrichts als auch alle sonstigen Kosten. Unterricht ist an öffentlichen Sonderschulen für die Schüler unentgeltlich. Die Kosten hierfür hat daher das Land zu tragen. Nicht erfasst von der Schulgeldfreiheit sind alle nichtunterrichtlichen Leistungen für Schüler, wie z. B. die Heimunterbringung, die Grund- und Behandlungspflege sowie die tagesstrukturierenden Angebote für die externen Schüler. Während die Kosten der Heimunterbringung vom zuständigen Sozialhilfeträger im Rahmen der Eingliederungshilfe des Sozialgesetzbuchs Zwölftes Buch (SGB XII) für Behinderte refinanziert werden, verbleiben die Kosten der Grund- und Behandlungspflege sowie der tagesstrukturierenden Angebote für externe Schüler beim Land.
Der Rechnungshof untersuchte die Refinanzierungsmöglichkeiten der Kosten für die tagesstrukturierenden Angebote sowie für die Grund- und Behandlungspflege an Staatlichen Heimsonderschulen.
2 Tagesstrukturierende Angebote für externe Schüler
Die externen Schüler werden nicht nur unterrichtet, sondern erhalten entsprechend ihrer individuellen Behinderung auf Kosten des Landes sogenannte tagesstrukturierende Angebote. Dies sind Maßnahmen, die erforderlich und geeignet sind, dem behinderten externen Schüler den Schulbesuch an einer Heimsonderschule zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.
Behinderte Schüler haben gegenüber dem zuständigen Sozialhilfeträger im Rahmen der Eingliederungshilfe einen Rechtsanspruch auf Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung. Dieser Anspruch umfasst grundsätzlich auch tagesstrukturierende Angebote für externe behinderte Schüler an Heimsonderschulen. Der Sozialhilfeträger ist allerdings nach den §§ 75 ff. SGB XII nur dann zur Vergütung erbrachter Leistungen der Eingliederungshilfe verpflichtet, wenn zwischen ihm und dem Leistungserbringer bzw. seinem Verband eine Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung getroffen wurde. Eine solche Vereinbarung fehlt für die tagesstrukturierenden Angebote, die externe behinderte Schüler an Staatlichen Heimsonderschulen erhalten. Dies hat zur Folge, dass das Land auf eine mögliche Refinanzierung seiner diesbezüglichen Kosten faktisch verzichtet. Bemerkenswert ist, dass private Heimsonderschulen, anders als die Staatlichen Heimsonderschulen, mit den Sozialhilfeträgern entsprechende Vereinbarungen getroffen haben und daher für ihre externen Schüler eine Vergütung für die tagesstrukturierenden Angebote erhalten.
Das Land ist verpflichtet, alle Einnahmequellen auszuschöpfen und mögliche Ansprüche geltend zu machen. Hierzu zählen auch alle Möglichkeiten der Refinanzierung von entstandenen Kosten. Auf eine mögliche Kostenerstattung darf deshalb nicht verzichtet werden.
Eine Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung nach den §§ 75 ff. SGB XII muss insbesondere die wesentlichen Leistungsmerkmale sowie die Höhe der Leistungsvergütung festlegen. Für die tagesstrukturierenden Angebote bedeutet dies, dass die Leistungen zu spezifizieren und die Vergütungen hierfür auszuhandeln sind. Eine solche Vereinbarung sichert allerdings nur dann die Refinanzierung der dem Land entstandenen Kosten, wenn diese zuvor im Wege einer angemessenen und wirtschaftlichen Kosten- und Leistungsrechnung möglichst genau bestimmt wurden.
Private Heimsonderschulen erhalten derzeit von den zuständigen Sozialhilfeträgern je externen Schüler für die tagesstrukturierenden Angebote eine durchschnittliche monatliche Vergütung von rd. 500 €. Würden die Sozialhilfeträger die Eingliederungshilfe des Landes vergüten, so hätte das Land im Schuljahr 2006/07 für die 1.233 externen Schüler insgesamt 7,39 Mio. € eingenommen. Verzichtet das Land auch künftig auf eine Vergütungsvereinbarung mit den Sozialhilfeträgern, so entsteht ein jährlicher Einnahmenausfall von mindestens 7 Mio. €.
3 Kosten der Grund- und Behandlungspflege für gesetzlich krankenversicherte Schüler
An den Staatlichen Heimsonderschulen werden auch Schüler unterrichtet, die schwer- und mehrfachbehindert sind und daher der Grund- und Behandlungspflege während des Schulbetriebs bedürfen.
Die Kosten der Grund- und Behandlungspflege werden derzeit vom Land getragen. Begründet wird dies mit der bisherigen Regelung des § 37 Abs. 2 SGB V, wonach gesetzlich Versicherte nur dann einen Anspruch auf Grund- und Behandlungspflege im Rahmen der „häuslichen Krankenpflege“ haben, wenn diese im Haushalt des Versicherten geleistet wird. 2007 sind im Staatshaushaltsplan 68.000 € zur Sicherstellung der medizinischen Behandlungspflege für schwer- und mehrfachbehinderte Schüler veranschlagt. Es ist offen, ob der etatisierte Betrag die tatsächlichen Kosten der medizinischen Behandlungspflege in den Staatlichen Heimsonderschulen deckt, da diese Schulen über keine detaillierte Kostenrechnung verfügen.
§ 37 SGB V wurde durch das Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 26.03.2007 geändert. Diese Neufassung gewährt Versicherten nunmehr einen Anspruch auf häusliche Krankenpflege nicht nur in ihrem Haushalt, sondern auch an sonst geeigneten Orten, insbesondere in betreuten Wohnformen, Schulen und Kindergärten. Gesetzlich krankenversicherte Schüler haben somit gegenüber ihrer Krankenkasse einen Anspruch auf Grund- und Behandlungspflege in Staatlichen Heimsonderschulen, wenn diese zur Sicherung des Ziels ärztlicher Behandlung erforderlich und angeordnet ist. Die Kosten hierfür hat deshalb nicht das Land, sondern haben die Krankenkassen zu tragen. Das Land hat daher in geeigneter Form dafür Sorge zu tragen, dass anfallende Kosten für medizinische Behandlungspflege solcher Schüler durch die zuständigen Krankenkassen refinanziert oder durch Dritte getragen werden.
Verzichtet das Land auf diese Refinanzierungsmöglichkeit, entsteht ein Einnahmeausfall zumindest in Höhe des bisher etatisierten Aufwandes von jährlich 68.000 €. Da die tatsächlichen Kosten dieser Leistungen nicht bekannt sind, ist nicht auszuschließen, dass ein wesentlich höherer Einnahmeausfall besteht.
4 Empfehlungen
Der Rechnungshof ist der Auffassung, dass bei allen nichtpädagogischen Leistungen der Staatlichen Heimsonderschulen zu prüfen ist, ob Dritte Kostenträger sein könnten. Besteht eine entsprechende Verpflichtung auch nur gegenüber den Leistungsempfängern (Schüler), so ist durch geeignete Maßnahmen darauf hinzuwirken, dass - möglichst kostendeckend - die Leistungen des Landes über die Kostenträger refinanziert werden.
Der Rechnungshof empfiehlt im Einzelnen,
- die Kosten aller nichtpädagogischen Leistungen der Eingliederungshilfe, die vom Land in Staatlichen Heimsonderschulen für externe Schüler erbracht werden, soweit wirtschaftlich vertretbar, möglichst umfassend und genau durch eine geeignete Kostenrechnung zu bestimmen;
- mit dem zuständigen Träger der Sozialhilfe für externe Schüler eine Leistungs-, Vergütungs- und Prüfungsvereinbarung zu treffen, damit die Leistungen, die das Land im Rahmen der Eingliederungshilfe erbringt, möglichst umfassend refinanziert werden;
- die Kosten der notwendigen Grund- und Behandlungspflege an Staatlichen Heimsonderschulen nur dann zu tragen, wenn keine anderen Kostenträger zur Finanzierung verpflichtet sind. Das Land sollte daher insbesondere in Anbetracht der Neufassung des § 37 SGB V prüfen, ob die Kosten für die notwendige Grund- und Behandlungspflege von den gesetzlichen Krankenkassen zu tragen sind.
5 Stellungsnahme des Ministeriums
Das Kultusministerium teilte hinsichtlich der tagesstrukturierenden Angebote an Staatlichen Heimsonderschulen mit, dass sich aufgrund der gestiegenen Nachfrage, die seitens der Erziehungsberechtigten und der zuständigen Kostenträger geäußert wurde, die Zahl der Tagesschüler erhöht habe. Das Ministerium verwies außerdem darauf, dass Aufgaben, die nicht Lehrkräften obliegen, vom jeweiligen Schulträger übernommen würden. Bei Staatlichen Heimsonderschulen sei dies das Land. Private Träger würden behinderungsspezifische tagesstrukturierende Angebote von den Landkreisen im Wege der Eingliederungshilfe refinanziert bekommen.
Das Kultusministerium werde den Bericht des Rechnungshofs zum Anlass nehmen, die Fragen einer möglichen Refinanzierung aufzubereiten und mit den Beteiligten zu erörtern.
Zum Thema Refinanzierung der Kosten für die Grund- und Behandlungspflege informierte das Kultusministerium, dass die Kosten der Grund- und Behandlungspflege bisher von den Schulträgern übernommen würden, die Grundpflege allerdings durch den Sachkostenbeitrag gedeckt sei. In Kürze würde mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales und danach mit der Landesvereinigung der Krankenkassen ein Gespräch über die Umsetzung der betreffenden Gesetzesänderung stattfinden.
6 Schlussbemerkung
Das Kultusministerium weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass die Stadt- und Landkreise als Schulträger von Sonderschulen auch die Leistungen trügen, welche Lehrkräfte nicht übernehmen würden. Dies ist zutreffend. Allerdings lässt das Kultusministerium außer Betracht, dass Stadt- und Landkreise in solchen Fällen sowohl die Aufgaben des Schulträgers als auch die des Sozialhilfeträgers wahrnehmen und ein Landkreis, trotz Funktionseinheit, Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII nicht als Schulträger, sondern als Sozialhilfeträger erbringt. Dagegen ist das Land zwar Schulträger von Staatlichen Heimsonderschulen, nicht jedoch Sozialhilfeträger. Die Kosten der Eingliederungshilfe für Schüler an Staatlichen Heimsonderschulen sind daher nicht vom Land, sondern von den zuständigen Sozialhilfeträgern zu übernehmen.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Die Fördermittel des IZBB-Programms wurden oft großzügig und fehlerhaft verteilt. Allein bei den untersuchten Maßnahmen wurden Zuwendungen in Höhe von 6,8 Mio. € zu viel bewilligt.
1 Ausgangslage
Ab dem Jahr 2003 stellte der Bund den Ländern zur Schaffung einer modernen Infrastruktur im Ganztagsschulbereich insgesamt 4 Mrd. € zur Verfügung; davon erhielt Baden-Württemberg 528,3 Mio. €. In den Jahren 2003 bis 2005 wurden für 566 Maßnahmen insgesamt 527,8 Mio. € bewilligt. Damit sollten nach den Planungen der Schulträger rd. 114.000 zusätzliche Ganztagsplätze geschaffen und rd. 31.500 schon vorhandene Ganztagsplätze weiterentwickelt werden.
Der Rechnungshof und das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Tübingen untersuchten bei den vier Regierungspräsidien 74 Maßnahmen an 85 Schulen, rd. 13 % der insgesamt bewilligten Maßnahmen. Überdies wurde bei diesen Schulen mit einem Erhebungsbogen ermittelt, wie sie ihren Ganztagsbetrieb gestalten und wofür die bewilligten Mittel tatsächlich verwendet werden. 16 Maßnahmen mit einem Fördervolumen von 46,7 Mio. € wurden außerdem bei den Schulträgern vor Ort geprüft.
2 Ergebnisse der Prüfung
2.1 Verteilung der Bundesmittel
Im Durchschnitt wurde jede Maßnahme mit 932.481 € bezuschusst. Der höchste Zuschuss für eine Maßnahme betrug 13,5 Mio. €. Die regionale Zuteilung der Bundesmittel an die Schulträger zeigt die Tabelle.
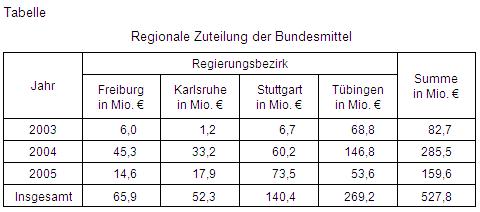
Da die Fördermittel des Investitionsprogramms des Bundes Zukunft Bildung und Betreuung (IZBB) nach dem „Windhundprinzip“ vergeben wurden, kam es zu einer ungleichen Mittelverteilung. Obwohl sich 2005 im Regierungsbezirk Tübingen nur 19,2 % (734) der allgemein bildenden Schulen des Landes befanden und dort nur ein Landesanteil von 17,4 % (210.770) Schülern unterrichtet wurde, entfielen mehr als die Hälfte der bewilligten Zuwendungen und mehr als ein Drittel der geförderten Maßnahmen auf diesen Bezirk. Die Feststellungen hierzu waren Gegenstand der Denkschrift 2005, Beitrag Nr. 8, Ganztagsschulen.
Daneben wirkte sich auf die Verteilung aus, dass die Einzelmaßnahmen in der Förderhöhe nicht begrenzt waren. Auffallend ist, dass mit einem hohen Zuwendungsanteil wenige Maßnahmen gefördert wurden und auch die Anzahl der neu zu schaffenden bzw. weiterzuentwickelnden Ganztagsplätze gering ausfällt. 15 Maßnahmen binden 20 % der IZBB-Mittel. Mit diesen Maßnahmen wurden nur 9,6 % zusätzliche Ganztagsplätze geschaffen und nur 4,1 % der bestehenden Ganztagsplätze weiterentwickelt.
2.2 Förderung eines Ganztagsplatzes
Mit den 138,5 Mio. € Zuwendungen der untersuchten 74 Maßnahmen sollten insgesamt mehr als 31.700 Ganztagsplätze neu geschaffen oder bestehende ausgebaut werden. Im Durchschnitt entfielen auf einen solchen Ganztagsplatz 4.365 €. An der Grund-, Haupt- und Realschule Schrozberg wurde jeder neue Ganztagsplatz mit 230 €, an der Eduard-Mörike-Schule in Bad Mergentheim mit 546 € und am Theodor-Heuss-Gymnasium in Aalen mit 1.031 € gefördert. Bei mehr als 20 % der Maßnahmen lag der Zuschuss je Ganztagsplatz über 10.000 €. An der Freien Waldorfschule in Ravensburg wurde jeder neue Ganztagsplatz mit 33.340 €, an der Illertalschule in Berkheim mit 41.103 € und am Gymnasium für Hochbegabte in Schwäbisch Gmünd sogar mit 71.000 € gefördert.
2.3 Bewilligungspraxis
Ein Regierungspräsidium bewilligte für drei Sporthallen Zuwendungen von mehr als 2,2 Mio. €, während die anderen Regierungspräsidien solche Förderungen ablehnten, da den Schulen bereits ausreichend Sportstätten zur Verfügung stünden. Außerdem könne bei einem Neubau der Nachweis für eine überwiegende Nutzung im Ganztagsbereich nicht erbracht werden.
Ein Regierungspräsidium legte für Kleinspielfelder pauschal förderfähige Kosten von 70.000 € zugrunde. Ein anderes Regierungspräsidium erkannte, in Anlehnung an die Kommunalen Sportstättenbauförderungsrichtlinien, bis zu 110.000 € an, während ein weiteres Regierungspräsidium die veranschlagten Kosten der Schulträger bis zu 123.000 € akzeptierte. Baugleiche Projekte wurden von den Regierungspräsidien mit bis zu 76 % Unterschied gefördert.
Ein Regierungspräsidium bewilligte auch Zuwendungen für nicht förderfähige Maßnahmen, wie beispielsweise Lehrerzimmer, Klassenräume, Zimmer der Schülermitverwaltung, Kauf eines VW-Busses.
Einem Schulträger wurden Zuwendungen für Ausstattungen von 228.000 € bewilligt, obwohl dieser nur 124.000 € beantragt hatte.
Einem Schulträger wurden Ende 2003 förderfähige Ausstattungskosten für 150 geplante Ganztagsplätze von nahezu 10.000 € je Platz anerkannt. Anfang 2004 legte das Kultusministerium die förderfähigen Ausstattungskosten auf 500 € je Ganztagsplatz bzw. auf maximal 15 % der Baukosten fest.
Einem Schulträger wurde der größte Teil der Kosten für den Neubau einer Ganztagsschule bewilligt, die Zuwendungen betrugen insgesamt 13,5 Mio. €.
Zwei Schulträger bezogen sich in den Anträgen auf die Bruttogrundfläche, obgleich sie wissen mussten, dass Grundlage für die Zuwendungsberechnung die Nettogrundfläche war. Ein anderer Schulträger gab im Antrag ein falsches Volumen des Bauwerks an. Ein weiterer Schulträger deklarierte eine Tribüne als grünes Klassenzimmer (siehe Abbildung). Das Tribünendach wurde aus einem anderen Förderprogramm bezuschusst. Diesen Schulträgern wurden deshalb überhöhte Zuwendungen bewilligt.

Die förderfähigen Kosten einer Mensa für ein Gymnasium wurden in Anlehnung an die Schulbauförderungsrichtlinien mit dem Kostenrichtwert von 2.520 €/m², die Mensa für eine Grund- und Hauptschule dagegen mit 2.290 €/m² berechnet, obwohl es sich um bauart- und kostengleiche Baumaßnahmen handelte.
Die Regierungspräsidien erkannten Baunebenkosten in einer Bandbreite von 13 % bis 20 % der förderfähigen Baukosten an.
3 Analyse und Bewertung
Das Kultusministerium setzte trotz eigener Programmverantwortung keine inhaltlichen Schwerpunkte für die Förderung der Ganztagsschulen und der Ganztagsbetreuung. Die einzelnen Maßnahmen wurden ohne sachliche Gewichtung ausschließlich nach dem zeitlichen Eingang der Anträge (Windhundprinzip) bewilligt.
Die Vorlage eines pädagogischen Konzepts war lediglich formale Fördervoraussetzung; auch für das Konzept selbst genügten rein formale Minimalangaben. Eine inhaltliche Ausrichtung und Grundbewertung der Konzepte für eine Landespriorisierung der zu fördernden Maßnahmen durch das Ressort wurde nicht vorgenommen. Die Vorgaben für das pädagogische Konzept konnten so weder eine inhaltlich-sachliche Steuerungsfunktion für die Investitionen noch eine solche für die Höhe derselben erfüllen. Denn bei Einhaltung der formalen Kriterien wurde jede inhaltliche Vagheit und jede kostenträchtige Wunschvorstellung als ausreichend für die Förderung einer Investition angesehen.
Die Antragssumme für eine Maßnahme oder einen Ganztagsschulplatz wurde der Höhe nach nicht begrenzt (Kostendeckelung). Es fehlte auch an einer dem Programmzweck entsprechenden Abgrenzung zwischen Investitionen, die für den Ganztagsbetrieb spezifisch erforderlich sind und denen, die bei jedem ordnungsgemäßen Schulbetrieb anfallen. Folglich wurden Vorhaben mit bis zu 13,5 Mio. € gefördert. Die Höhe der Zuwendung stand in keinem Bezug zu der geplanten Zahl der Ganztagsplätze. Deshalb wurden solche mit weniger als 500 € aber auch mit mehr als 70.000 € bezuschusst. Die enorme Spreizung der Zuwendungen für einen neuen Ganztagsplatz ist den unzulänglichen Vorgaben des Kultusministeriums anzulasten.
Das Kultusministerium versäumte auch, als Grundlage für die Bewilligungsbehörden mit der baufachtechnischen Dienststelle die Rahmenbedingungen zu definieren. Die Regelungen des Kultusministeriums zur Umsetzung des IZBB-Programms waren unzureichend konkretisiert oder wurden erst verspätet und zum Teil fehlerhaft getroffen. Dies führte zu großen Unsicherheiten und einer regional sehr unterschiedlichen Bewilligungspraxis. Das Kultusministerium ließ eine Förderpraxis zu, mit der nicht nur die spezifischen Mehrkosten von Ganztagsschulen, sondern auch Investitionen für den gesamten Schulbetrieb aus dem IZBB-Programm finanziert wurden.
Die lückenhaften Fördervorgaben setzten sich in einer großzügigen und oft fehlerhaften Förderpraxis der Bewilligungsstellen fort. So wurden u. a. kritiklos die Kostenschätzungen der Schulträger übernommen, in unzulässiger Weise Grundstücke, Erschließungskosten, Außenanlagen und die darauf entfallenden Baunebenkosten gefördert sowie den Berechnungen falsche Flächen- und Kostenrichtwerte zugrunde gelegt. In den beanstandeten Förderfällen hätten die Zuwendungen statt 36,0 Mio. € nur 32,1 Mio. € betragen dürfen; 3,9 Mio. € wurden zu viel bewilligt. Die Regierungspräsidien haben deshalb die Neufestsetzung der Zuwendungen zu prüfen.
Auch waren u. a. wegen veränderter oder nicht umgesetzter Bauausführung Zuwendungen um mindestens 2,9 Mio. € zu hoch festgesetzt. Die Regierungspräsidien haben in diesen Fällen die Zuwendungen neu festzusetzen.
Insgesamt war bei dem Förderprogramm weder beim Bund noch beim Land eine in sich schlüssige Konzeption erkennbar, weil die Förderung in der Hauptsache an formalen und weniger an inhaltlichen Kriterien ausgerichtet war. Die allgemeinen Formulierungen in der Verwaltungsvereinbarung des Bundes mit den Ländern können noch als Ausdruck für die schwierigen Kompromissverhandlungen gesehen werden. Den Ländern war aber eigens die Möglichkeit eingeräumt, die Fördermittel in diesem Rahmen angepasst an ihre jeweiligen Problemlagen einzusetzen und dafür genauere Vorgaben zu machen. Das Ministerium hat diesen Spielraum nicht genutzt.
Mit dieser Vorgehensweise vergab das Land die Chance, Fördermittel von weit mehr als einer halben Milliarde Euro entsprechend der spezifischen Problemlage in Baden-Württemberg bedarfsgerecht, zielgenau und wirtschaftlich einzusetzen.
4 Empfehlungen
Die Ergebnisse der Untersuchung des Investitionsprogramms IZBB zeigen in verschiedener Hinsicht Handlungsbedarf auf. Der Rechnungshof empfiehlt,
- bei den hauptsächlich mit IZBB-Mitteln finanzierten Schulneubauten die spezifischen Mehrkosten für den Ganztagsbetrieb zu ermitteln und nur diese als zuwendungsfähige Kosten anzuerkennen,
- alle Maßnahmen zügig zu überprüfen, um - so weit wie möglich - freiwerdende Mittel nach regionalen und sachlichen Gesichtspunkten innerhalb des Landes umzuverteilen und
- bei dem Landesprogramm „Chancen durch Bildung“ und dem Bundesprogramm zur Förderung von Investitionen für die Kleinkinderbetreuung, die Erkenntnisse dieser Untersuchung zu berücksichtigen.
5 Stellungnahme des Ministeriums
Das Kultusministerium bemerkt zunächst, der Rechnungshof vernachlässige in seiner Auslegung der Bekanntmachung des Landes, dass danach auch Neubaumaßnahmen möglich seien. Diese stünden insbesondere im Einklang mit der Verwaltungsvereinbarung des Bundes zum IZBB und trügen deren Zielsetzung Rechnung. Außerdem unterstelle die Kritik des Rechnungshofs einen Generalverdacht zulasten der Schulträger, obwohl diese die bereitgestellten Mittel entsprechend der Bekanntmachung bedarfsgerecht, zweckentsprechend und wirtschaftlich einsetzen müssen. Weiter weist das Ministerium die Vorwürfe des Rechnungshofs zurück, es habe unzureichend konkrete und unvollständige Regelungen bzw. Regelungen zu spät und zum Teil fehlerhaft getroffen. Vielmehr habe es durch zeitnahe Dienstbesprechungen aktuelle Fragen und Probleme im Zusammenhang mit dem IZBB mit den Regierungspräsidien erörtert. In einem komplexen Förderprogramm könnten naturgemäß auch unvorhersehbare Einzelfragen auftauchen, die im Blick auf eine zeitnahe und unbürokratische Umsetzung in der Bekanntmachung nicht abschließend geregelt werden können. Die unbürokratische Umsetzung habe bei hoher Akzeptanz der Schulträger dazu geführt, dass die zur Verfügung gestellten Fördermittel vollständig belegt und entsprechend der Intention des Bundes an Ganztagsschulen verwendet werden konnten.
Die Entscheidung nach Antragseingang sei ein rasches und ökonomisches Verfahren, das mit den Kommunalen Landesverbänden abgestimmt sei und eine objektive Grundlage für messbare Kriterien gewährleisten würde.
Alle pädagogischen Konzepte der Antragssteller seien - entsprechend der Intention der Verwaltungsvereinbarung - auf ihre Tragfähigkeit sowie auf die zur Umsetzung erforderlichen Investitionen hin geprüft worden.
Die Antragsteller hätten ein Recht auf ermessensfehlerfreie Entscheidung bei der Auswahl der förderfähigen Vorhaben. Eine Änderung dieser Praxis für möglicherweise zurückfließende Mittel würde diesem Grundsatz entgegenstehen. Das Ministerium äußert Bedenken, ob der Vorschlag des Rechnungshofs, Zuschussbescheide für den „schulischen Teil“ bei Neubau und Neueinrichtung von Ganztagsschulen zurückzunehmen, rechtlich umsetzbar sei. Es sieht hier ein beträchtliches Prozessrisiko.
Bei den neuen Programmen seien das Kultusministerium und das Ministerium für Arbeit und Soziales auf die Anregungen des Rechnungshofs weitgehend eingegangen. Ein Windhundverfahren werde es nicht geben, im Übrigen seien Höchstbeträge und Pauschalen vorgesehen.
Im Ergebnis könne sich das Kultusministerium mit den Empfehlungen des Rechnungshofs zum Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Erziehung“ nicht einverstanden erklären.
6 Schlussbemerkung
Der Rechnungshof bleibt bei seinen Empfehlungen. Eine wesentliche Erkenntnis seiner Untersuchung ist, dass insbesondere bei Förderprogrammen mit hoher finanzieller Ausstattung mehr als bisher darauf geachtet werden sollte, ob die beabsichtigten Wirkungen auch tatsächlich erreicht werden. Die Rückabwicklung gescheiteter Förderverfahren zählt zu den üblichen Verwaltungsaufgaben, die mit einer Förderung zwangsläufig verbunden sind.
Der Rechnungshof regt dringend an, bei solchen Programmen durch eine angemessene Steuerung die bedarfs- und zielgerichtete, zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der öffentlichen Mittel sicherzustellen.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Einzelplan 07: Wirtschaftsministerium
Kommunale Tourismuseinrichtungen, insbesondere Heilbäder, sollten nur dann gefördert werden, wenn sie künftig wirtschaftlich aus eigener Kraft existieren können. Als Grundlage für die Förderung ist ein Konzept zu entwickeln, das Förderschwerpunkte definiert und einen zielgerichteten Einsatz der Mittel ermöglicht. Das Verteilen der Fördermittel ausschließlich nach den Wünschen der Kommunen ist nicht im Interesse des Landes.
1 Ausgangslage
Die Landesregierung misst der Tourismusförderung eine wichtige regional- und strukturpolitische Bedeutung zu. Die Förderung soll eine kontinuierliche Entwicklung des Tourismus in Kur- und Erholungsorten sichern, strukturschwache Gebiete unterstützen und den Erholungs- und Freizeitwert steigern. Die touristischen Ziele im Land konkurrieren mit touristischen Attraktionen im In- und Ausland. Für die Wettbewerbsfähigkeit sei eine kontinuierliche und qualitative Weiterentwicklung der Infrastruktur erforderlich. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Kommunalen Investitionsfonds (KIF).
Die Landesregierung schätzt den Anteil des Tourismus am Bruttoinlandsprodukt auf mehr als 5 %. Die Zahl der Gästeankünfte ist seit 1986 von rd. 10 Millionen auf rd. 15 Millionen im Jahr 2006 gestiegen. Dagegen sinkt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den touristischen Zielorten seit einigen Jahren stetig und lag zuletzt im Jahr 2006 bei 2,7 Tagen.
2 Förderkonzept
Nach der Richtlinie des Wirtschaftsministeriums über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung öffentlicher Tourismusinfrastruktureinrichtungen bezwecken die Zuwendungen
- die Qualitätsverbesserung und Attraktivitätssteigerung,
- die Stärkung der ökologischen Ausrichtung,
- die Unterstützung der Entwicklung strukturschwacher Gebiete,
- die Erhöhung des Erholungs- und Freizeitwertes sowie
- den Ausbau und die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit.
Insgesamt wurden den Kommunen in den Jahren von 1986 bis 2006 rd. 230,5 Mio. € für den Ausbau der öffentlichen Tourismusinfrastruktur zur Verfügung gestellt und damit Investitionen von knapp 528 Mio. € initiiert. Hinzu kommen die Investitionen, die durch die Pauschalförderung in den Jahren von 1994 bis 1997 ausgelöst wurden.
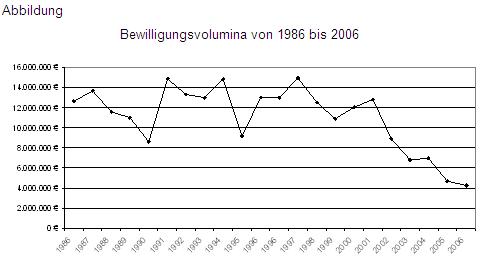
Im geprüften Zeitraum von 2002 bis 2006 wurde das jährlich zur Verfügung stehende Bewilligungsvolumen von rd. 8,8 Mio. € auf rd. 4,3 Mio. € reduziert. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum rd. 32 Mio. € bewilligt. Damit wurden bei den geförderten Kommunen Investitionen in Höhe von rd. 110 Mio. € initiiert.
3 Prüfungsfeststellungen
3.1 Erfüllung des Förderzwecks
Die in der Förderrichtlinie genannten fünf Förderzwecke (siehe Pkt. 2) sind so offen formuliert, dass darunter fast jedes Vorhaben subsumiert werden kann. So kann z. B. nicht bewertet werden, inwieweit ein gefördertes Vorhaben zu einer konkreten Stärkung der ökologischen Ausrichtung beiträgt. Das Wirtschaftsministerium hat mindestens 19 geförderten Vorhaben eine ökologische Ausrichtung attestiert, darunter auch Aussichtstürmen.
Die Wirkung von Fördermaßnahmen auf den Erholungs- und Freizeitwert sowie auf den Ausbau und die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit ist kaum messbar.
3.2 Einzelfälle
In den Jahren von 2002 bis 2006 wurden 108 Maßnahmen mit einem Bewilligungsvolumen in Höhe von rd. 32 Mio. € gefördert. Davon hat der Rechnungshof 40 Maßnahmen mit einem Fördervolumen in Höhe von rd. 7,3 Mio. €, mithin rd. 22 % des Gesamtfördervolumens, auf ihre ordnungsgemäße Bewilligung und Abrechnung hin näher geprüft.
Die stichprobenweise überprüften Umsetzungen und Abrechnungen von Einzelmaßnahmen waren mehrheitlich nicht zu beanstanden. Gleichwohl war in Einzelfällen festzustellen, dass Teile von geförderten Vorhaben veräußert, nicht förderfähige Kosten abgerechnet oder nicht förderfähige Maßnahmen bewilligt worden waren. Dazu zählen folgende Beispiele:
- Eine Gemeinde hatte eine Zuwendung in Höhe von 37.500 € erhalten, um von der Uferpromenade Anlegemöglichkeiten für Segeltouristen zu schaffen. Wegen vorzeitigen Maßnahmebeginns und wahrheitswidriger Angaben im Antrag wurde die Zuwendung zurückgefordert.
- Eine andere Gemeinde hatte eine Zuwendung für verschiedene Maßnahmen im Umfeld eines Bauernhausmuseums in Höhe von rd. 160.000 € erhalten. Diese Maßnahmen dienen nicht überwiegend dem Tourismus und hätten nicht gefördert werden dürfen.
- Eine weitere Gemeinde hatte eine Zuwendung zur Generalsanierung ihrer Schwimmhalle in Höhe von rd. 188.000 € erhalten. Dieses Projekt hätte nicht gefördert werden dürfen, weil die Schwimmhalle bereits bei der Antragstellung nicht touristisch genutzt wurde.
Im Laufe der Prüfung haben die betroffenen Kommunen insgesamt rd. 114.000 € an die Verwaltung zurückgezahlt. Ein weiteres Rückforderungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen.
4 Wirtschaftliche Entwicklungen von Heilbädern
Baden-Württemberg ist das Land mit den meisten anerkannten Kurorten. 57 höher klassifizierte Heilbäder und Kurorte bieten ein vielfältiges Angebot für unterschiedlichste Wünsche und Bedürfnisse. Auf die wirtschaftliche Situation der Heilbäder wirken sich neben konjunkturellen Entwicklungen insbesondere Leistungskürzungen aus den Gesundheitsreformen und das veränderte Nachfrageverhalten der Kunden aus. Dadurch ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Heilbädern von sechs Tagen in 1998 auf 4,8 Tage im Jahr 2006 gesunken.
Die Heilbäder agieren in einem sich ständig wandelnden Gesundheits- und Tourismusmarkt. Dabei stehen sie im Spannungsfeld zwischen der notwendigen Anpassung ihrer Angebote aufgrund der sich ändernden touristischen und medizinischen Ansprüche und der Finanzierbarkeit notwendiger Renovierungs- und Erweiterungsinvestitionen. Zwar wurden den Heilbädern in den Jahren 2002 bis 2006 insgesamt Zuwendungen in Höhe von rd. 18 Mio. € bewilligt, mithin rd. 56 % der insgesamt bewilligten Fördermittel für Einzelmaßnahmen im Tourismusbereich. Trotzdem besteht ein erheblicher Finanzbedarf, der die Bäderbetreiber selbst, aber auch zahlreiche der ohnehin finanzschwachen Kommunen an die Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit bringt.
Die wirtschaftliche Situation ist in einigen Heilbädern prekär. In Gemeinde A führten wirtschaftliche Probleme im März 2007 zur Insolvenz der Kurmittelhaus GmbH. Seit dem 03.09.2007 ist eine Schweizer Stiftung Mieterin des Thermalbades.
Die Gemeinde B musste im Jahr 2004 ihren Zuschuss an die örtliche Bäder- und Touristik GmbH erhöhen, weil die Hälfte des Stammkapitals dieser GmbH aufgezehrt war. Ende 2005 konnte eine bilanzielle Überschuldung nur durch eine Sonderzuweisung der Stadt abgewendet werden. Auch für das Jahr 2006 wurde ein hoher Nachschuss der Stadt zur Abwendung der Insolvenz geleistet.
Weitere Heilbäder könnten in vergleichbare Schieflagen geraten. Ein wesentlicher Grund hierfür sind auch die regelmäßig hohen Investitionsausgaben für erforderliche Modernisierungen und Erweiterungen von Thermal- und ähnlichen Bädern. Bei einzelnen Heilbädern war erkennbar, dass grundlegende Neu- und Erweiterungsinvestitionen nicht oder nur rudimentär durchgeführt wurden. Vielfach ließ die Finanzlage lediglich Erhaltungsmaßnahmen in geringerem Umfang zu, die dann eher kosmetischen Operationen glichen.
Bei Bädern ist von einem Lebenszyklus von 15 Jahren auszugehen, „wobei die wirtschaftlich erfolgreichen Bäderbetreiber in kurzen Abständen (alle 1 bis 2 Jahre) neue Einrichtungen nachrüsten bzw. umfangreiche Renovierungen durchführen“. Investitionen und Innovationen sind aber notwendig, weil anderenfalls Einkommenszuwächse in den Heilbädern und Kurorten in Baden-Württemberg kaum zu erwarten sind. Angesichts der wirtschaftlichen Lage der Thermalbäder und der Haushaltssituation der betroffenen Gemeinden ist es teilweise problematisch oder überhaupt fraglich, ob eine solche Investitionsstrategie konsequent und nachhaltig umgesetzt werden kann. Die entsprechenden Investitionen führen zu steigendem Aufwand (z. B. durch zusätzlichen Personalbedarf, Abschreibungen). Das kann bei einem rückläufigen Nutzungsgrad zu finanziellen Lücken führen.
Ein weiterer Grund für wirtschaftliche Schwierigkeiten ist die Pflicht für Heilbäder, infrastrukturelle Einrichtungen wie z. B. Kurpark, Spazierwege und Kurmittelhäuser anzubieten. Diese Einrichtungen können regelmäßig nur verlustbringend bewirtschaftet werden.
5 Vergleich mit den Staatsbädern
Der Rechnungshof hat im November 2007 seine Beratende Äußerung „Die BKV - Bäder- und Kurverwaltung Baden-Württemberg und ihre Beteiligungen an Bäder- und Kurunternehmen“ veröffentlicht. Dort wird u. a. festgestellt, dass die Unterhalts- und Investitionsausgaben für die Staatsbäder bzw. die Bäder- und Kurunternehmen mit Landesbeteiligung den Landeshaushalt mit durchschnittlich 10 Mio. € im Jahr belasten und der Rückzug des Landes gefordert. In seiner Sitzung am 03.04.2008 hat der Landtag die Landesregierung ersucht darzulegen, welche strategischen Ziele sie mit dem Betrieb der Staatsbäder verfolgt.
Vergleichbar mit den Staatsbädern sind die kommunalen Heilbäder im Sinne von § 4 des Gesetzes über die Anerkennung von Kur- und Erholungsorten. Im Zeitraum von 2002 bis 2005 wurden 13 Heilbäder zusammen mit jährlich knapp 3 Mio. € gefördert. Dies unterstreicht die Wettbewerbsverzerrung, die mit der Landesförderung an die drei Staatsbäder Badenweiler, Bad Mergentheim und Bad Wildbad verbunden ist.
6 Wertung und Empfehlungen
Der Rechnungshof hält es für erforderlich, den Förderzweck so zu konkretisieren, dass im Nachhinein die Erreichung des Förderzwecks gemessen und bewertet werden kann.
Ferner sollte die bisherige Förderstrategie überdacht werden. Es liegt nicht im Interesse des Landes, viele Tourismus-Institutionen ohne Rücksicht auf deren wirtschaftliche Überlebensfähigkeit zu fördern. Die begrenzten Mittel sollten dort eingesetzt werden, wo sie ertragsfähige Investitionen auslösen. Eine solche Schwerpunktsetzung bedingt auch die Bereitschaft, Förderanträge abzulehnen.
Erforderlich ist auch eine engere Abstimmung der Förderprogramme, wie z. B. mit dem Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum bei der Förderung von Kleinvorhaben. Die bestehenden Bestrebungen des Wirtschaftsministeriums hierzu bilden einen wichtigen Schritt in diese Richtung.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Heilbäder ist teilweise besorgniserregend. Es steht zu befürchten, dass einige Heilbäder verstärkt in wirtschaftliche Probleme bis hin zur Insolvenz geraten. Bei künftigen Förderentscheidungen sollte die Wirtschaftlichkeit der Maßnahme deutlicher im Vordergrund stehen. Bei größeren Projekten sollten daher Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Kosten-Nutzen-Analysen oder andere geeignete Wirtschaftlichkeitsnachweise vorliegen. Grundlage der Förderung sollte ferner eine belastbare Prognose über die wirtschaftliche Entwicklung sein.
Das Wirtschaftsministerium sollte als Grundlage für Förderentscheidungen eine zukunftsweisende Bäderkonzeption erarbeiten. Diese muss der besonderen wirtschaftlichen Bedeutung dieses Tourismuszweiges gerecht werden. In diesem Zusammenhang sollte auch das Problem der wenig marktkonformen Wettbewerbssituation zwischen den kommunalen und den staatlichen Heilbädern aufgearbeitet werden.
Insbesondere sollten Gemeinden häufiger und intensiver zusammenarbeiten und so im Sinne einer regionalen Gesamtentwicklung Multiplikatoren- und Synergieeffekte nutzen.
Das Wirtschaftsministerium steht einer „staatlich gelenkten Planung über Art, Umfang, Häufigkeit und Dichte öffentlicher touristischer Infrastruktureinrichtungen“ mit dem Hinweis auf die kommunale Selbstverwaltung nach wie vor ablehnend gegenüber. Es betont aber, dass es mit den in den Förderrichtlinien formulierten Grundsätzen, wie z. B. der Förderung innovativer Vorhaben, hinreichend Einfluss auf die Ausrichtung der kommunalen Investitionen in die touristische Infrastruktur nehme.
Das Wirtschaftsministerium hat die Erarbeitung einer neuen Tourismuskonzeption für 2008 angekündigt. Dieses Konzept soll „aufbauend auf einer Analyse des Marktes und der Stärken und Schwächen des baden-württembergischen Tourismus und den Perspektiven der zukünftigen Tourismusentwicklung Ziele und Leitlinien für den Tourismus des Landes ableiten sowie die zukünftigen Aktionsfelder und Handlungsschwerpunkte identifizieren“.
7 Stellungnahme des Ministeriums
In zahlreichen Punkten folgt das Wirtschaftsministerium den Argumenten des Rechnungshofs. Bei der Infrastrukturförderung hingegen vertritt es die Auffassung, wesentliche qualitative Ziele seien nicht ohne Weiteres messbar.
Die Prüfung der Bedürftigkeit des Förderempfängers hält das Ministerium für entbehrlich, weil mit der Veranschlagung der Mittel aus dem Kommunalen Investitionsfonds für das Tourismusinfrastrukturprogramm der generelle Bedarf an entsprechenden Investitionen und deren finanzielle Unterstützung begründet werde. Mit dem Tourismusförderprogramm und den Förderrichtlinien werde den Anforderungen des § 23 LHO hinreichend entsprochen.
Das Wirtschaftsministerium erwartet für die Heilbäder eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Der Gesundheitstourismus werde aufgrund der Alterung der Bevölkerung und weiter steigender Lebenserwartung sowie zunehmenden Gesundheitsbewusstseins wachsen.
In diesem Zusammenhang hält das Wirtschaftsministerium eine verbindliche Bäderkonzeption für nicht zielführend. Vielmehr müssten die Verantwortlichen vor Ort flexibel Entscheidungen treffen können, um sich den wechselnden Marktverhältnissen und -bedürfnissen anpassen zu können.
Die Tourismuskonzeption solle im Laufe des Jahres 2008 fortgeschrieben werden, wobei die Feststellungen des Rechnungshofs einbezogen würden. Entsprechendes gelte für die beabsichtigte Überarbeitung der Förderrichtlinie, die auf der Grundlage der fortgeschriebenen Tourismuskonzeption erfolgen solle.
8 Schlussbemerkung
Der Rechnungshof hält an seiner Auffassung fest, dass die wirtschaftliche Tragfähigkeit von Tourismusinvestitionen entscheidend für deren Förderfähigkeit sein sollte.
Gerade auch deshalb ist eine Bäderkonzeption unter Einbeziehung des Heilbäderverbandes als Basis für Förderentscheidungen nötig. Mit einer solchen Konzeption könnten auch Wettbewerbsverzerrungen zwischen den kommunalen und auch den staatlichen Bädern abgebaut werden.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Einzelplan 08: Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum
Das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem ist ein kompliziertes und aufwendiges Verfahren der europäischen Agrarpolitik. Durch Vereinfachung und Optimierung des Verfahrens sowie Verbesserung der technischen Ausstattung kann das System wesentlich effizienter und effektiver gestaltet werden. Zudem sollte eine einheitliche Verwaltungspraxis sichergestellt werden.
1 Ausgangslage
Das Integrierte Verwaltungs- und Kontrollsystem (InVeKoS) wurde von der Europäischen Kommission als Förder- und Kontrollsystem eingeführt, um die Gemeinsame Agrarpolitik in den Mitgliedstaaten einheitlich umzusetzen.
InVeKoS besteht derzeit aus fünf Bestandteilen:
- Datenbank zur Erfassung und Verarbeitung der Daten der Beihilfeempfänger,
- System zur Identifizierung landwirtschaftlich genutzter Parzellen,
- System zur Kennzeichnung und Registrierung von Tieren,
- System zur Bearbeitung und Auszahlung von Beihilfeanträgen sowie
- Verwaltungskontrollen und Vor-Ort-Kontrollen (integriertes Kontrollsystem).
Dem InVeKoS unterliegen in Baden-Württemberg sämtliche Fördermaßnahmen der ersten Säule (EU-Direktzahlungen) und die Flächenprämien der zweiten Säule (Förderung der ländlichen Entwicklung) der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU mit einem Fördervolumen von rd. 585 Mio. € (im Jahr 2006). Der überwiegende Teil der Mittel stammt von der EU (rd. 493 Mio. €), die weiteren Mittel stammen vom Bund (rd. 17 Mio. €) sowie vom Land (rd. 75 Mio. €). Das Land ist für die Bearbeitung der Verfahren zuständig.
2 Prüfungsanlass und Prüfungsziel
Neben dem hohen Fördervolumen waren auch sogenannte Anlastungen aus den Jahren 2003 bis 2005 von rd. 4,7 Mio. € Prüfungsanlass. Zu Anlastungen und damit Rückzahlungsverpflichtungen gegenüber der EU kommt es, wenn bei der Überprüfung der Zahlungen Fehler festgestellt werden, die über einer definierten Fehlertoleranz liegen. Die Prüfung hatte zum Ziel, die Umsetzung des umfangreichen und komplexen Systems aufzunehmen, zu analysieren und Empfehlungen zur Vereinfachung zu geben. Damit sollen der Verwaltungsaufwand und das Anlastungsrisiko reduziert werden.
3 Umsetzung des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems in Baden-Württemberg
Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum ist in seiner Funktion als Zahlstelle für die Einrichtung und ordnungsgemäße Durchführung von InVeKoS gegenüber der EU verantwortlich. Die Umsetzung vor Ort erfolgt durch die unteren Landwirtschaftsbehörden. Die Regierungspräsidien nehmen die Fachaufsicht über die unteren Landwirtschaftsbehörden wahr, sie sind außerdem mit Controllingaufgaben zur Qualitätssicherung und -verbesserung betraut.
Die Zahlstellenreferate des Ministeriums und das Entwicklungs- und Betreuungszentrum für Informations- und Kommunikationstechnik des Ministeriums (EBZI) wickeln für die unteren Landwirtschaftsbehörden zentrale Arbeiten ab und stellen DV-Programme bereit. Sie übernehmen die zentrale Entwicklung der DV-Fachverfahren, die Softwareprogrammierung, den Produktbetrieb für die Abwicklung der DV-Verfahren und die Betreuung der Förderprogramme auf allen Verwaltungsebenen. Weiterhin zahlen sie die Fördermittel aus und werten die Daten für alle Berichtspflichten aus. Eine Erschwernis liegt darin, dass die Vorgaben teilweise verspätet eingehen und mit veralteten Datenbanken in Einklang gebracht werden müssen.
Die dem InVeKoS unterliegenden Fördermaßnahmen werden im Rahmen des Verfahrens zum sogenannten Gemeinsamen Antrag abgewickelt. Er besteht aus einem allgemeinen Teil, aus mehreren maßnahmenbezogenen Teilen und aus dem Flurstücksverzeichnis sowie weiteren Unterlagen, wie beispielsweise Schlagskizzen oder Vertragsunterlagen. Der allgemeine Teil umfasst Angaben zum Antragsteller und seinem Unternehmen. Mit dem Maßnahmenteil können die einzelnen Förder- und Ausgleichsmaßnahmen beantragt werden. Ein Antrag kann bis zu 12 einzelne Förderprogramme umfassen. Im Flurstücksverzeichnis hat der Antragsteller sämtliche Flächen bzw. Flurstücke, die er selbst bewirtschaftet, die jeweilige Nutzungsart und die beantragten flurstücksbezogenen Fördermaßnahmen aufzuführen. Umfasst werden die Flurstücksdaten entsprechend dem Liegenschaftskataster, die maximal landwirtschaftlich nutzbare Fläche (sogenannte Bruttofläche) und verschiedene Angaben zur Nutzung. Der Verfahrensablauf und die einzelnen Bearbeitungsschritte sind in der Abbildung dargestellt.
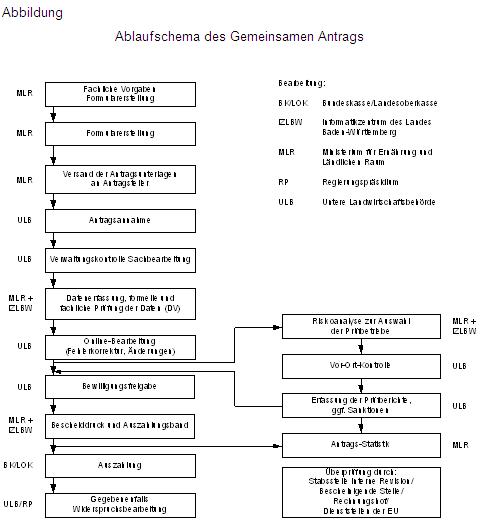
4 Feststellungen
4.1 Kosten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems
Die jährlichen Verwaltungskosten des Landes für InVeKoS wurden vom Rechnungshof mit rd. 55 Mio. € ermittelt. Danach verursacht jeder Antrag durchschnittlich knapp 1.000 € Kosten. Diese hohen Kosten erklären sich vor allem durch den in der Abbildung dargestellten vielstufigen Verfahrensablauf.
4.2 Bestimmung der sogenannten Bruttoflächen
Aufgrund der einschlägigen EG-Verordnungen haben die Mitgliedstaaten ein Flächenreferenzsystem einzuführen; sie wurden verpflichtet, bis zum 01.01.2005 die maximal beihilfefähige Fläche je landwirtschaftliche Referenzparzelle festzustellen. Im Gegensatz zu der überwiegenden Mehrheit der Länder hat Baden-Württemberg entschieden, sein Referenzsystem auf den vorhandenen Katasterdaten aufzubauen. Dies hatte den Vorteil, dass keine grundlegende flächendeckende Digitalisierung und Vermessung erforderlich war. Das Land nutzt die bestehenden Daten der Vermessungsverwaltung und das automatisierte Liegenschaftskataster. Dadurch konnten erhebliche Kosten für neue Befliegungen zur Erstellung von Orthofotos, für die Aufbereitung des Karten- bzw. Datenmaterials sowie die Digitalisierung von Referenzflächen gespart werden.
Neben der reinen Katasterfläche ist für die Förderung die Bruttofläche als Prüfgröße erforderlich.
Die landwirtschaftlich nutzbare Fläche ist die nach den Förderungskriterien der EU maximal beihilfefähige Fläche. Sie kann deutlich von der Katasterfläche abweichen, da diese die Dynamik der Nutzungsänderungen nicht erfasst. Die maximale landwirtschaftliche Fläche wird durch technische Verschneidung verschiedener Datengrundlagen festgelegt; sie erfordert eine manuelle Nacharbeit. Hierzu ist ggf. auch eine aufwendige Feldbesichtigung erforderlich. Somit ist für einen Großteil der bewirtschafteten Flächen die Flächengröße noch nicht abschließend festgestellt. Da aber fehlerhafte Bruttoflächen zu Überzahlungen führen können, liegt hierin ein erhöhtes Anlastungsrisiko.
4.3 Verwaltungspraxis bei Antragsannahme, Rückforderungen und Sanktionen
Die Praxis der unteren Landwirtschaftsbehörden bei Antragsannahme, Rückforderungen und Sanktionen war uneinheitlich, obwohl die Arbeitsabläufe durch Regelungen vorgegeben sind. Vor allem der Zeitaufwand für die Antragsannahme war sehr unterschiedlich und reichte von 3 Minuten bis zu 100 Minuten, der Durchschnittswert lag bei 30 Minuten. Dies kann zum einen am Antragsumfang liegen, z. B. Anzahl der Förderverfahren, Umfang des Flächenverzeichnisses oder Qualität des abgelieferten Antrags. Zum anderen wurden Unterschiede in der Beratungsintensität festgestellt. Diese variierten von ausführlicher Beratung im Sinne der Förderoptimierung bis zu bloßer Entgegennahme des Förderantrags mit Vollständigkeits- und Plausibilitätskontrolle.
Auch bei Rückforderungen und Sanktionen wegen Flächenabweichungen wurde bei den einzelnen unteren Landwirtschaftsbehörden sehr unterschiedlich verfahren. Beispielsweise wurde von einer unteren Landwirtschaftsbehörde bei Flächenabweichungen grundsätzlich die Gutgläubigkeit des Antragstellers unterstellt. Daher wurden die zu Unrecht bezahlten Beihilfen nur über den verkürzten Zeitraum von vier Jahren zurückgefordert. Eine andere untere Landwirtschaftsbehörde geht dagegen immer davon aus, dass für Flächenabweichungen grundsätzlich die Antragsteller verantwortlich seien; dies macht aufwendige Rückverfolgungen bis zu zehn Jahren erforderlich.
4.4 Vor-Ort-Kontrollen
Nach der einschlägigen EG-Verordnung müssen 5 % der Anträge einer Vor-Ort-Kontrolle unterzogen werden. Die Durchführung einer herkömmlichen Vor-Ort-Kontrolle mit Feldbesichtigung ist mit einem erheblichen Personalaufwand verbunden. Der größte Aufwand wird dabei durch die Kontrolle der Flächen mit umfangreichen Vorarbeiten zur Identifizierung der Fläche, insbesondere aber durch die erforderliche Nachmessung der tatsächlich vorgefundenen Fläche verursacht. Dagegen ist die örtliche Prüfung, ob Verpflichtungen, Auflagen und Förderbedingungen eingehalten wurden, im Anschluss an die Flächenidentifizierung meist verhältnismäßig schnell durchführbar. Legt man die Zahlen des Ministeriums zugrunde, belaufen sich die Kosten für die herkömmlichen Vor-Ort-Kontrollen mit Feldbesichtigung einschließlich der zusätzlichen Feldbesichtigungen im Rahmen der Fernerkundung auf rd. 8 Mio. € je Jahr.
4.5 Aufwendige Korrekturen von Flächenabweichungen
Die im Rahmen der Vor-Ort-Kontrollen und der Bruttoflächenfeststellung ermittelten Flächenabweichungen sind in der Regel sehr gering und ergeben meist einen Rückforderungsbetrag, der unter der hierfür geltenden Bagatellgrenze von 100 € liegt. Obwohl diese Überzahlungen nicht eingezogen werden, müssen die Flächenabweichungen nach einer entsprechenden Sachverhaltsermittlung auch für die Vorjahre korrigiert und ein Rückforderungsbescheid erlassen werden. Der damit verbundene Verwaltungsaufwand beträgt in der Mehrzahl der Fälle sicherlich mehrere 100 €. Hinzu kommt der Aufwand für die sich aus Flächenabweichungen ergebende Änderung der Zahlungsansprüche auf EU-Direktzahlungen; auch hier geht es meist um sehr geringe Beträge.
5 Empfehlungen
5.1 Empfehlungen für den Landesbereich
5.1.1 Reduzierung und Vereinfachung der Förderprogramme der zweiten Säule
Die Programmvielfalt und die Zahl der Fördermaßnahmen in der zweiten Säule (Förderung des Ländlichen Raums) sollten reduziert werden. Damit sollten auch eine Vereinfachung der Programme einhergehen sowie teilweise ein gegenseitiger Förderausschluss (siehe dazu auch Denkschrift 2007, Beitrag Nr. 22, Förderprogramme im Geschäftsbereich des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum). Baden-Württemberg hat im europäischen sowie im bundesdeutschen Vergleich die größte Anzahl von Fördermaßnahmen der zweiten Säule. Insbesondere die große Anzahl von Agrarumweltmaßnahmen führt zu einem beträchtlichen Verwaltungsaufwand, weil jede Einzelmaßnahme eine spezielle Bearbeitung erfordert.
5.1.2 Anhebung der Mindestauszahlungsbeträge in der zweiten Säule
Auch im Hinblick auf die hohen Bearbeitungskosten je Antrag sollten die Mindestauszahlungsbeträge für die Flächenmaßnahmen der zweiten Säule auf 500 € angehoben werden. Damit würde die Zahl der Anträge deutlich reduziert, wodurch die Verwaltung entsprechend entlastet würde. Das Ministerium hat auf die Vorschläge des Rechnungshofs in der zweiten Säule teilweise reagiert und die Mindestauszahlungsbeträge auf 250 € angehoben.
5.1.3 Bruttoflächen
Die Bruttoflächen sollten weiterhin mit höchster Priorität abschließend festgestellt werden. Andernfalls sind finanzielle Nachteile für das Land zu befürchten, weil nicht überprüfte Flächen ein erhöhtes Anlastungsrisiko enthalten. Zur effizienteren Aufgabenerledigung empfiehlt es sich, die Bruttoflächenüberprüfung und die Vor-Ort-Kontrolle zusammen durchzuführen. Die Überprüfung der Bruttoflächen von Betrieben, die nicht zur Vor-Ort-Kontrolle ausgewählt wurden, sollte flächenbezogen erfolgen. Die Zusammenfassung von benachbarten Betriebsflächen wäre mit Blick auf notwendige Vor-Ort-Besichtigungen mit erheblich weniger Reisezeiten verbunden. Zudem müssten sich die Bediensteten nicht jedes Mal mit der örtlichen Situation neu befassen, sodass die Arbeit wesentlich schneller als bisher erledigt werden könnte.
5.1.4 Erhöhung des Fernerkundungsanteils bei den Vor-Ort-Kontrollen
Die vorgeschriebenen Vor-Ort-Kontrollen bei Flächenmaßnahmen können wahlweise durch Feldbesichtigung oder durch Fernerkundungsmethoden aufgrund von Luft- oder Satellitenaufnahmen erfolgen. Die Kosten der Fernerkundung belaufen sich auf rd. 30 % der herkömmlichen Vor-Ort-Kontrolle. Durch eine Erhöhung des Fernerkundungsanteils bei den Vor-Ort-Kontrollen können die Verfahrenskosten deutlich verringert werden. Daher sollte der Anteil der Fernerkundung bei den Direktzahlungen der ersten Säule deutlich erhöht werden. Der Rechnungshof schlägt hier einen Anteil von mindestens 80 % vor. Auch die Kontrolle von Lage, Größe und Nutzung der Flächen sollte bei Maßnahmen der zweiten Säule weitestgehend über die Fernerkundung erfolgen, sodass lediglich die Einhaltung der fachlichen Vorgaben durch eine Inaugenscheinnahme vor Ort überprüft werden muss.
5.1.5 Verbesserung der zentralen Leistungen und der DV-Ausstattung
Immense verfahrenstechnische Vereinfachungen können durch eine verbesserte DV-technische Ausrüstung erreicht werden. Das veraltete benutzerunfreundliche DV-Umfeld ist an aktuelle Standards anzupassen und die Weiterentwicklung der DV-Architektur sollte mit geeignetem Personal vorangetrieben werden.
Der Prüfdienst sollte für die Feldbesichtigungen mit Tablet-Laptops ausgestattet werden. Mit diesen speziellen Laptops können die vorhandenen Daten vor Ort elektronisch aktualisiert, Medienbrüche vermieden und der Aufwand im Vergleich zur herkömmlichen Arbeitsweise deutlich reduziert werden. Ebenso dient die Verwendung von Tablet-Laptops bei Feldbesichtigungen der beschleunigten Feststellung der Bruttoflächen. Die hierdurch entstehenden erheblichen Zusatzkosten müssen allerdings durch Kostenreduzierung, z. B. im Personalbereich, gegenfinanziert werden.
5.1.6 Ausbau der elektronischen Antragstellung
Die Einführung der Internetanwendung „Flächeninformation und Online-Antrag (FIONA)“ ist zu begrüßen. Die Antragsteller sollten weiterhin durch geeignete Maßnahmen veranlasst werden, ihre Anträge verstärkt mit FIONA zu bearbeiten und elektronisch an die Verwaltung zu schicken. Anträge, insbesondere Flurstücksverzeichnisse, die mit FIONA erstellt wurden, haben den großen Vorteil, dass sie 30 - 60 % weniger Fehler aufweisen, als Anträge, die traditionell in Papierform erstellt wurden. Dadurch verringerte sich der Verwaltungsaufwand für die Antragsbearbeitung erheblich. Zudem können der Personalanteil bei der Antragsannahme sowie der Kostenaufwand für die externe Datenerfassung deutlich reduziert werden. Weitere Einsparungen sind möglich, wenn FIONA zur vollständigen elektronischen Antragstellung weiterentwickelt wird. Durch die sinkende Fehlerquote sinkt auch das Anlastungsrisiko.
5.1.7 Einheitliche Verwaltungspraxis
Bei der Antragsannahme sollten die unteren Landwirtschaftsbehörden im Sinne einer einheitlichen Verwaltungspraxis die Anträge nur auf Vollständigkeit und Plausibilität prüfen. Ausführliche Beratungen, die der Förderoptimierung dienen können, sollten im Vorfeld - beispielsweise durch die Bauernverbände - erfolgen.
Ebenso sollte bei Rückforderungen und Sanktionen darauf geachtet werden, dass gleich gelagerte Fälle landesweit gleich behandelt werden und eine entsprechende Einzelfallprüfung stattfindet. Durch Erlasse, Schulungen und weiteren Erfahrungsaustausch sollte eine einheitliche Verwaltungspraxis gewährleistet und somit auch das Anlastungsrisiko gemindert werden. Angesichts der komplexen Antragsverfahren ist wünschenswert, dass die Sachbearbeiter längerfristig in den Dienststellen verbleiben. Dadurch könnte langfristige Erfahrung aufgebaut und genutzt werden.
5.2 Empfehlungen zur Änderung der Vorgaben der EU
Weitere Optimierungen sind durch eine Änderung der europäischen Vorschriften möglich. Wünschenswert wäre insbesondere eine Öffnungsklausel, die es den Mitgliedstaaten gestattet, den Mindestauszahlungsbetrag im Rahmen der ersten Säule, analog zum Vorschlag für die Maßnahmen der zweiten Säule, von 100 € auf 500 €, zu erhöhen.
Anträge mit einem niedrigen Auszahlungsbetrag sind nicht geeignet, die Existenz eines landwirtschaftlichen Unternehmens, auch nicht im Nebenerwerb, zu sichern. Sie tragen kaum zur Erreichung der Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik bei. Erste Diskussionen diesbezüglich sind Ende 2007 in der Europäischen Gemeinschaft eröffnet worden.
Das Land sollte darauf hinwirken, dass die EU die Mitgliedstaaten bei InVeKoS autorisiert, eine Bagatellgrenze für die Rückverfolgung von kleinen Flächenabweichungen in Höhe von 0,3 ha einzuführen. Dies begründet sich zum einen in dem unverhältnismäßigen Aufwand für die vergangenheitsorientierte Korrektur und Rückverfolgung von kleinen Flächenabweichungen und zum anderen in der Dynamik der Grenzen landwirtschaftlich genutzter Flächen, wovon Baden-Württemberg besonders betroffen ist. Zugleich sollte angestrebt werden, dass die EU für die sich aus Flächenabweichungen ergebende Änderung der Zahlungsansprüche bei den Direktzahlungen eine Bagatellgrenze von 0,1 ha einführt. Die EU hat im Dezember 2007 nach langwierigen Verhandlungen für die Neuzuteilung von Zahlungsansprüchen infolge von Flächenkorrekturen rückwirkend ab 2005 eine Bagatellgrenze von 50 € je Antragsteller zugestanden.
6 Stellungnahme des Ministeriums
Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum hält die vom Rechnungshof ermittelten Kosten für InVeKoS von jährlich rd. 55 Mio. € - oder von durchschnittlich knapp 1.000 € je Antrag - für nicht zutreffend und geht seinerseits von einem abweichenden Berechnungsansatz und Gesamtkosten in Höhe von rd. 47 Mio. € - oder rd. 800 € je gemeinsamem Antrag - aus.
Im Hinblick auf die vielfältigen politischen und gesellschaftlichen Zielsetzungen sei es nur begrenzt möglich, die Förderprogramme der zweiten Säule zu vereinfachen, zu reduzieren und die Mindestauszahlungsbeträge anzuheben. Die jeweiligen Mindestauszahlungsbeträge seien bereits im Rahmen des Vertretbaren angehoben worden.
Das Ministerium pflichtet dem Rechnungshof bei, dass der abschließenden Feststellung der Bruttoflächen höchste Priorität einzuräumen sei. Dazu sei zusätzliches qualifiziertes Personal erforderlich. Deshalb habe der Ministerrat am 13.11.2007 beschlossen, hierfür landesweit Personal der unteren Vermessungsbehörden mit heranzuziehen.
Das Ministerium werde, wie empfohlen, Lösungsansätze untersuchen, die einer Verbesserung der zentralen Leistungen und der DV-Ausstattung dienen.
Das Ministerium strebt eine deutliche Erhöhung des Anteils der Förderanträge an, die über FIONA gestellt werden. Hinsichtlich der Weiterentwicklung zur vollständigen elektronischen Antragstellung seien die weiteren Entwicklungen zur elektronischen Signatur auf Bundesebene abzuwarten. Bis dahin stehe die Weiterentwicklung von FIONA im Fokus der Arbeiten.
Die Bearbeitung von Rückforderungen und Sanktionen werde durch detaillierte Vorgaben und verstärkt durch Fortbildungsveranstaltungen unterstützt.
Die Empfehlungen des Rechnungshofs zur Änderung der EU-Vorgaben werden vom Ministerium begrüßt.
7 Schlussbemerkung
Der Rechnungshof geht weiterhin von jährlich rd. 55 Mio. € Gesamtkosten für InVeKoS und knapp 1.000 € je Antrag aus. In der Stellungnahme des Ministeriums sind die Berechnungen des Rechnungshofs nicht nachvollziehbar widerlegt. Der vom Ministerium angewandte Berechnungsansatz wurde nicht dargelegt. Auch bei den vom Ministerium genannten Kosten von rd. 800 € je Antrag sollten alle Möglichkeiten der Vereinfachung und Kostenreduzierung, auch auf EU-Ebene, ausgeschöpft werden.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Bei der Förderung nach der Richtlinie Ausgleichszulage Landwirtschaft können die vorhandenen Fördermittel durch die Konzentration auf die stärker benachteiligten Gebiete, wie z. B. das Berggebiet, wesentlich effektiver und effizienter eingesetzt werden. In den gering bis gar nicht benachteiligten Gebieten ist eine Förderung nicht zu rechtfertigen. Durch Vereinfachungen sowie durch die Anhebung des Mindestauszahlungsbetrages auf 500 € lässt sich zudem der Verwaltungs- und Kontrollaufwand erheblich reduzieren.
1 Ausgangslage
Die Ausgleichszulage Landwirtschaft ist ein von der EU und vom Bund mitfinanziertes Förderprogramm für landwirtschaftliche Betriebe in benachteiligten Gebieten. Sie soll wirtschaftliche Anreize für eine weitere Bewirtschaftung der Flächen bieten. Durch einen Zuschuss sollen die wirtschaftlichen Folgen von ungünstigen Boden- und Klimabedingungen (natürliche Benachteiligung) ausgeglichen und so in den abgegrenzten benachteiligten Gebieten eine standortgerechte Landbewirtschaftung gesichert werden. In der Folge soll damit der Fortbestand der landwirtschaftlichen Bodennutzung gewährleistet und eine wirtschaftlich lebensfähige Gemeinschaft im ländlichen Raum erhalten werden. Die Förderung soll nachhaltige Bewirtschaftungsformen unterstützen und auch den Belangen des Umweltschutzes Rechnung tragen.
Insgesamt sind rd. 62 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche des Landes Baden-Württemberg als benachteiligtes Gebiet ausgewiesen. Im Jahr 2005 wurden rd. 25.000 Antragsteller mit einem Volumen von 52,59 Mio. € auf einer Fläche von rd. 625.000 ha gefördert. Die in der neuen Förderperiode der EU geänderten finanziellen Rahmenbedingungen führten dazu, dass das Mittelvolumen um ein Drittel auf jährlich rd. 36 Mio. € gekürzt wurde.
Die Ausgleichszulage war bereits 1998 Gegenstand eines Denkschriftbeitrags. Da nicht alle der damaligen Empfehlungen des Rechnungshofs umgesetzt und zusätzlich Steillagen der sogenannten Handarbeitsstufe in die Förderung einbezogen wurden, war eine erneute Überprüfung angezeigt. Dabei sollte insbesondere untersucht werden, inwieweit die für die Ausgleichszulage genannten Ziele mit geringerem finanziellem Aufwand erreicht werden können.
2 Einkommensgrenzen
Nach Abschaffung der früheren Einkommensgrenzen fallen in den Kreis der Begünstigten auch Nebenerwerbslandwirte, die Landwirtschaft betreiben, um zusätzliches Einkommen zu erzielen, oder ein Hobby verfolgen (z. B. Reitsport). Eine Förderung ist hier nicht notwendig. Sie dient dazu, landwirtschaftliche Erwerbstätigkeit zu sichern und ständige natürliche und wirtschaftliche Nachteile auszugleichen. Es widerspricht dem Wirtschaftlichkeitsgrundsatz und dem genannten Einkommensziel, Bewirtschaftern mit außerlandwirtschaftlichen Einkommen über bestimmten Einkommensgrenzen Ausgleichszulage zu gewähren, die diese Flächen allein im Hinblick auf die Erhaltung ihres Erholungs- und Freizeitwertes oder Marktwertes bewirtschaften. Zur Vermeidung von Mitnahmeeffekten könnte es sich anbieten, die ab 2007 abgeschaffte Einkommensgrenze wieder einzuführen. Zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes könnte sich dabei die Prüfung auf Stichproben und Verdachtskontrollen beschränken. Bei einer solchen Vorgehensweise entsteht kein merklicher Aufwand für die Prüfung der Einkommensgrenze.
3 Mindestauszahlungsbetrag
Die Erhebungen haben ergeben, dass gut ein Drittel aller Anträge (9.646 Anträge) zur Ausgleichszulage unter 500 € liegen. Diese Anträge betreffen lediglich rd. 3 % des gesamten Auszahlungsvolumens (1,7 Mio. €) und nur knapp 10 % der förderfähigen Fläche der Ausgleichszulage. Im Sinne eines effizienteren Mitteleinsatzes sollte der Mindestauszahlungsbetrag der Ausgleichszulage auf 500 € festgesetzt werden. Insoweit ist eine weitere Anhebung über den von der EU-Kommission geforderten Betrag von 250 € anzustreben.
4 Feststellungen und Empfehlungen zur Förderstruktur
Die Förderung ist stark ausziseliert und knüpft an verschiedene Gesichtspunkte an; die Kombination der Gesichtspunkte erscheint nicht widerspruchsfrei.
Die Zugehörigkeit von Flurstücken zum benachteiligten Gebiet ergibt sich aus dem seit 1989 unveränderten Gebietsverzeichnis. Die Höhe der Ausgleichszulage wird nach Gebietskategorie (Berggebiet, Berggebiet Allgäu und benachteiligte Agrarzone), Art der Flächennutzung (Grünland und Ackerland) und der Bodengüte gestaffelt (siehe Tabelle). Die Bodengüte bemisst sich nach der durchschnittlichen Landwirtschaftlichen Vergleichszahl (LVZ) der Gemarkung. Im Falle der Grünlandnutzung wird im Berggebiet ein Festbetrag von 150 €/ha und im Berggebiet Allgäu ein Festbetrag von 142 €/ha gewährt. In der benachteiligten Agrarzone hängt die Höhe der Förderung von der Gemarkungs-LVZ und von der Nutzung ab. So wird für Grünland mit einer LVZ von 15 ein Betrag von 120 €/ha gewährt; mit zunehmender Bodengüte wird der Auszahlungsbetrag abgesenkt; bei einer LVZ von 24 werden 50 €/ha gewährt. Für Flächen, die trotz einer höheren LVZ im benachteiligten Gebiet liegen, erfolgt keine weitere Degression, d. h. auch für diese Flächen werden 50 €/ha ausgezahlt. Für Ackernutzung liegt die Förderung generell bei 25 €/ha. Für Grünlandnutzung auf Flächen der Handarbeitsstufe wird der Förderhöchstsatz von 200 €/ha gewährt.

4.1 Höhe und Bemessung der Förderung
Die von der EU vorgegebene und im Auftrag des Ministeriums für Ernährung und Ländlichen Raum durchgeführte externe Evaluierung der Ausgleichszulage hat gezeigt, dass bei Betrieben mit einer LVZ von über 26 Überkompensationen gegeben sind, da hier vielfach kein Einkommensrückstand gegenüber den nicht geförderten Betrieben vorlag. Das Fördervolumen für die Betriebe in der benachteiligten Agrarzone mit einer LVZ von über 26 beträgt entsprechend der für das Antragsjahr 2005 berechneten Beträge rd. 12 Mio. €.
Im Sinne einer effektiveren Verwendung sollten die knapperen Ausgleichszulage-Mittel zielgerichtet für die stärker benachteiligten Gebiete eingesetzt werden. Dies ist aber bei der Neustaffelung der Fördersätze durch das Ministerium ab dem Jahr 2007 gerade nicht geschehen. Bei Betrieben in Gemarkungen mit einer LVZ von 27 fällt die erfolgte Reduzierung bei Grünlandnutzung betragsmäßig sogar geringer aus als im stärker benachteiligten Berggebiet. Die Mittel sollten auf die stärker benachteiligten Gebiete, insbesondere das Berggebiet und Gebiete mit geringer LVZ, konzentriert, im Gegenzug die Förderung der gering benachteiligten Gebiete reduziert und dort, wo Überkompensationen festgestellt wurden, auf eine Förderung ganz verzichtet werden. In der benachteiligten Agrarzone sollte daher ab einer LVZ von über 26 auf eine Förderung verzichtet werden. Da rund die Hälfte aller Anträge zur Ausgleichszulage Betriebe mit einer LVZ von über 26 betreffen, könnte so auch der Verwaltungs- und Kontrollaufwand erheblich reduziert werden.
Auch bei dem einheitlichen Fördersatz von 25 € je Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche für die Ackernutzung muss in Frage gestellt werden, ob dieser zur Erreichung der Förderziele merklich beiträgt. Ein Landwirt, der 10 ha Ackerland bewirtschaftet, erhält jährlich nur 250 €, selbst 100 ha Ackerland werden mit lediglich 2.500 € jährlich gefördert. Das Ministerium führt an, dass sich bei Ackerflächen die Ziele auch mit einer reduzierten Förderung erreichen lassen, weil eine Stilllegung nicht drohe. Durch extensivere und rationellere Bewirtschaftung blieben die Flächen in der Produktion. Vor dem Hintergrund des zunehmenden Bedarfs an nachwachsenden Rohstoffen werde es eine Nachfrage nach Ackerflächen auch künftig geben. Unter dieser Prämisse wäre es konsequent, auf eine Förderung von Ackerflächen im Rahmen der Ausgleichszulage völlig zu verzichten und die Mittel auf Gebiete zu konzentrieren, deren Bewirtschaftung gefährdet ist.
4.2 Handarbeitsstufe
Die Förderung von Steillagen der sogenannten Handarbeitsstufe betraf im Jahr 2004 landesweit nur 0,6 % der Gesamtförderfläche und 1,5 % des Gesamtauszahlungsvolumens (788.400 €). Die Flächen sind aber überwiegend ohnehin stark benachteiligtes Gebiet, größtenteils Berggebiet, sodass der Anteil für die Handarbeitsstufe meist nur 50 €/ha beträgt, was ein Viertel der Gesamtauszahlungssumme bedeutet. Die Handarbeitsflächen bereiten der Verwaltung im Vergleich zum ausbezahlten Prämienvolumen unverhältnismäßig große Schwierigkeiten. Unter den meist schwierigen topografischen Verhältnissen der Handarbeitsflächen ist eine exakte Abgrenzung nach der Hangneigung sehr schwierig. Die geprüften Ämter waren deshalb gezwungen, einen unverhältnismäßig hohen Personaleinsatz für die Festlegung und die Korrektur der Flächen der Handarbeitsstufe zu erbringen.
Die Flächen der Handarbeitsstufe wurden von der Verwaltung elektronisch abgespeichert. Dem Antragsteller sind sie jedoch nicht bekannt, da er sie weder dem Flurstücksverzeichnis noch dem von der Verwaltung zur Verfügung gestellten Kartensatz entnehmen kann. Da der Antragsteller selbst nicht wissen kann, welche Flächen das Kriterium Handarbeitsstufe erfüllen, muss er bei der Antragstellung lediglich durch Ankreuzen kenntlich machen, dass er die Ausgleichszulage beantragt; alles Weitere erfolgt auf der Grundlage der elektronisch abgespeicherten Gebietskulisse. Wenn im Rahmen einer Vor-Ort-Kontrolle Korrekturen an den Flächen erforderlich werden, werden Sanktionen gegenüber dem Antragsteller erlassen, obwohl er für fehlerhafte Flächenangaben nicht verantwortlich ist.
Der unverhältnismäßig hohe Verwaltungsaufwand, das Anlastungsrisiko gegenüber der EU und die Rechtsunsicherheit der Antragsteller sind Gründe, die eine rasche Änderung des Fördersystems erfordern. Die Förderung von Flächen der Handarbeitsstufe sollte nicht mehr an der Hangneigung, sondern an anderen Kriterien ausgerichtet werden. Beispielsweise könnten wie in Bayern und Österreich die als Berggebiet ausgewiesenen Flächen automatisch mit dem Förderhöchstsatz der Handarbeitsstufe gefördert werden. Für die wenigen Handarbeitsflächen außerhalb der Berggebiete könnte sich für ausgewählte Flächen eine zielgerichtetere Förderung nach der Landschaftspflegerichtlinie anbieten.
4.3 Kleine Gebiete
Bei der Erweiterung des Fördergebiets im Jahr 1989 wurden Moorwiesen, Steillagen und Überschwemmungswiesen als sogenannte Kleine Gebiete in die Gebietskulisse einbezogen. Dabei finden sich nur Teile (Flurstücke) von Gemeinden bzw. Gemarkungen im Fördergebiet. Der Anteil der Kleinen Gebiete am gesamten Auszahlungsvolumen der Ausgleichszulage beträgt weniger als 1 %. Die durchschnittliche Gemarkungs-LVZ der überprüften Gebiete liegt meist relativ hoch, was für gute landwirtschaftliche Bedingungen spricht. Bei den Stichproben wurde festgestellt, dass die Ausweisungskriterien hinsichtlich der Überschwemmungswiesen häufig nicht mehr vorlagen und als Steillagen auch Flächen berücksichtigt wurden, welche die geforderte Hangneigung nicht erfüllen. Angesichts der genannten Tatsachen sollte die Förderung der kleinen Gebiete eingestellt werden.
5 Mehrfachförderung landwirtschaftlicher Flächen
Der Rechnungshof hat bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass für landwirtschaftliche Flächen mit Pflege- oder Extensivierungsverträgen nach der Landschaftspflegerichtlinie entweder keine Ausgleichszulage gewährt oder eine gewährte Ausgleichszulage auf das Pflegegeld angerechnet werden sollte.
Zweck der Extensivierungsverträge nach der Landschaftspflegerichtlinie ist es, einen Ausgleich für die extensivierungsbedingten Bewirtschaftungskosten zu gewähren, die nicht durch Erträge gedeckt sind. Dabei wurde die Höhe der Zahlungen auskömmlich kalkuliert. Demgegenüber soll die Ausgleichszulage geringere Erträge bei der Bewirtschaftung von Flächen in benachteiligten Gebieten ausgleichen. Beide Maßnahmen führen also aus unterschiedlichen Gründen zu einem finanziellen Ausgleich, der in benachteiligten Gebieten unbegründet kumuliert wird. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass ein Landwirt in einem Gebiet mit guten natürlichen Ertragsbedingungen durch den Abschluss eines Extensivierungsvertrags deutlich höhere Ertragseinbußen und damit auch höhere finanzielle Einbußen hinzunehmen hat als sein Kollege in einem benachteiligten Gebiet. Somit besteht eine Situation, in der Landwirte in benachteiligten Gebieten durch den Abschluss eines Extensivierungsvertrags zwar weniger Ertragseinbußen, jedoch - aufgrund der Kombination von Extensivierungsvertrag und Ausgleichszulage - einen deutlich höheren finanziellen Ausgleich erhalten. Auf landwirtschaftlichen Flächen mit Pflege- und Extensivierungsverträgen sollte daher keine Ausgleichszulage gewährt werden. Die Förderung nach der Landschaftspflegerichtlinie kann durch die vertragliche Ausgestaltung zielgerichteter erfolgen und verringert dadurch das Anlastungsrisiko.
Die Mehrfachförderung der landwirtschaftlichen Flächen durch die Ausgleichszulage und durch das Pflegegeld nach der Landschaftspflegerichtlinie gestaltet sich auch bei der Umsetzung problematisch. Bei Pflegeverträgen nach der Landschaftspflegerichtlinie kann Ausgleichszulage nur dann gleichzeitig gewährt werden, wenn der Aufwuchs landwirtschaftlich genutzt wird. Dies muss zweifelsfrei im Pflege- und Extensivierungsvertrag vereinbart sein und auch im Vollzug nach dem Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystem der EU (InVeKoS) kontrolliert werden. Die Prüfung des Rechnungshofs hat gezeigt, dass dieses Erfordernis nicht einheitlich umgesetzt und von den unteren Landwirtschaftsbehörden individuell ausgelegt wird. Die Umsetzung verursacht einen unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand. Außerdem unterliegt das Land hinsichtlich der Kontrolle der bisherigen Regelungen einem nicht unerheblichen Anlastungsrisiko gegenüber der EU.
6 Bewertung und Empfehlungen
Die für den Förderzeitraum 2010 vorzunehmende Neustrukturierung der Ausgleichszulage sollte die Wirksamkeit und die Effizienz in den Vordergrund stellen. Statt der bisherigen multifunktionalen Zieldimension sollte sich die Ausgleichszulage auf ein Hauptziel bzw. wenige Ziele konzentrieren und schlüssig in die bestehende Förderlandschaft einfügen. Statt die immer knapper werdenden Finanzmittel nach der „Rasenmähermethode“ zu marginalisieren, sollten die Fördermittel auf die stärker benachteiligten Gebiete, wie z. B. das Berggebiet, konzentriert werden. Der Rechnungshof hat empfohlen, in diesem Zusammenhang die Abgrenzungskriterien für die Berggebiete und damit auch die Gebietsfläche im Berggebiet zu erweitern und die Förderung der Steillagen zu vereinfachen. Er hält einen Förderausschluss der sogenannten Kleinen Gebiete für sachgerecht.
Die weitere Reduzierung des Verwaltungs- und Kontrollaufwands sollte oberste Priorität haben. Als Folge der empfohlenen Maßnahmen wird die Anzahl der Anträge voraussichtlich halbiert werden. Eine weitere Verminderung der Antragszahlen wäre durch die Erhöhung des Mindestauszahlungsbetrags auf 500 € zu erwarten. Um Überkompensationen und Mitnahmeeffekte zu vermeiden, könnte neben der von der EU ab 2010 vorgesehenen degressiven Staffelung der Ausgleichszulage in Abhängigkeit vom Flächenumfang eine aufwandsarme Prosperitätsregelung (Einkommensgrenze) eingeführt werden.
7 Stellungnahme des Ministeriums
Das Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum hält eine Einkommensgrenze weder für notwendig noch für praktikabel. Die vom Rechnungshof dargestellte aufwandsarme Umsetzung der Einkommensgrenze lasse sich nicht realisieren.
Die geforderte Anhebung des Mindestauszahlungsbetrags auf 500 € laufe der Zielsetzung der Ausgleichszulage zuwider, da für die Offenhaltung der Landschaft in benachteiligten Regionen gerade auch kleine Betriebe von besonderer Bedeutung seien.
Der hohe Verwaltungsaufwand zur Bearbeitung der Anträge aus der Handarbeitsstufe sei gerechtfertigt, da die Anhebung der Förderung auf den Höchstsatz in den Berggebieten zahlreiche Flächen der Handarbeitsstufe außerhalb der Berggebiete nicht berücksichtige. Die Empfehlung, die Förderung dieser Flächen über die Landschaftspflegerichtlinie vorzunehmen, würde den Verwaltungsaufwand und das Anlastungsrisiko nur verlagern, nicht aber reduzieren.
Das Ministerium verweist weiter darauf, dass im Rahmen der Reduzierung des Fördervolumens aufgrund geringerer EU-Mittel die Förderung stärker benachteiligter Gebiete geringer abgesenkt wurde als in weniger benachteiligten Gebieten und damit der zielgerichtete Einsatz der Fördermittel gewährleistet sei. Angesichts der von der EU auf das Jahr 2010 vorgegebenen Überprüfung der gesamten Gebietskulisse sei der vom Rechnungshof geforderte Förderausschluss der sogenannten „Kleinen Gebiete“ zum jetzigen Zeitpunkt nicht zweckmäßig.
Zur Mehrfachförderung führt das Ministerium aus, die Ausgleichszulage gleiche nur natürliche Benachteiligungen landwirtschaftlicher Flächen aus, während die Förderung nach der Landschaftspflegerichtlinie nur Umweltleistungen ausgleiche und entsprechend kalkuliert werde. Eine Kombination der beiden Programme für landwirtschaftlich genutzte Flächen diene den unterschiedlichen Zielsetzungen und sei auch durch die EU so zugelassen.
Da die Empfehlungen des Rechnungshofs erst vorgelegen hätten, nachdem die Neustaffelung der Ausgleichszulage der EU-Kommission zur Genehmigung bereits vorgelegt worden war, hätten sie schon aus zeitlichen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden können.
8 Schlussbemerkung
Der Rechnungshof hält daran fest, dass die Mittel zielführender verteilt werden sollten, wodurch zugleich der Verwaltungs- und Kontrollaufwand reduziert würde. Auch wenn seine Empfehlungen erst vorlagen, als die Neustaffelung der Ausgleichszulage bei der EU-Kommission bereits eingereicht worden war, steht dies einer Umsetzung zum nächsten Förderjahr nicht entgegen.
Bei der Neustrukturierung sollten die Fördermittel umgehend auf die stärker benachteiligten Gebiete, zulasten der gering bis praktisch nicht benachteiligten Gebiete, konzentriert werden.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Einzelplan 09: Ministerium für Arbeit und Soziales
Das Land trägt nahezu für alle Schwangerschaftsabbrüche nach der Beratungsregelung die Kosten. Durch Abrechnungspauschalen ließen sich die Verfahren vereinfachen und die Erstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen um jährlich 1,4 Mio. € verringern.
1 Ausgangslage
Die Kosten für einen rechtswidrigen aber straffreien Abbruch der Schwangerschaft nach der sogenannten Beratungsregelung sind grundsätzlich von der Frau zu tragen. Soweit sich Frauen in einer schwierigen wirtschaftlichen Notlage befinden, werden die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch zunächst von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Das Land erstattet diesen die verauslagten Kosten. Im Jahr 2006 betrug die Kostenerstattung des Landes 5,2 Mio. €.
Das Bundesverfassungsgericht wies darauf hin, dass der Gesetzgeber aufgrund seiner Schutzpflicht für ungeborenes Leben dafür verantwortlich sei, dass das Gesetz tatsächlich einen angemessenen und wirksamen Schutz vor Schwangerschaftsabbrüchen erziele. Es hat dem Gesetzgeber eine Beobachtungspflicht bzw. bei Bedarf eine Korrektur- oder Nachbesserungspflicht aufgetragen.
2 Entwicklung und Höhe der Erstattungsquote
Die Erstattungsquote des Landes errechnet sich aus dem Anteil der vom Land bezahlten Schwangerschaftsabbrüche an den jährlich dem Statistischen Bundesamt gemeldeten Schwangerschaftsabbrüchen von Frauen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg.
Die Entwicklung der Erstattungsquote sowie die Höhe der Erstattungen für die Jahre 1996 bis 2006 zeigt die Tabelle.
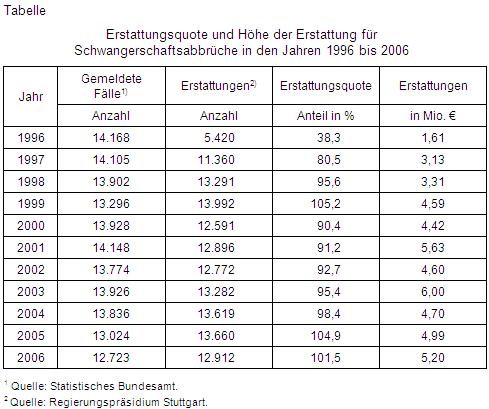
Diese vom Land ermittelten Erstattungsquoten sind interpretationsbedürftig, weil die Zeitbezüge der erhobenen Daten des Statistischen Bundesamtes und des Landes nicht identisch sind. Auch werden teils Schwangerschaftsabbrüche mehrfach gezählt, wenn Gynäkologen und Anästhesisten zu unterschiedlichen Abrechnungszeitpunkten ihre Rechnungen einreichen und jede Forderung eine andere Ordnungsnummer erhält. Landesweit hochgerechnet betrug die Erstattungsquote beispielsweise 2006 statt 101,5 % nur 91,8 %.
3 Einkommensverhältnisse und Vermögen der Frauen
Eine Betrachtung der Einkommensverhältnisse ergab, dass lediglich 31 % der erfassten Frauen laut eigenen Angaben überhaupt über ein Einkommen aus einem Beschäftigungsverhältnis verfügen. Die Auswertungsergebnisse der Antragsunterlagen verdeutlichen überdies, dass nur wenige Frauen über Einkommen verfügen, das die Mindesteinkommensgrenze erreicht, ab der die Kosten selbst zu tragen sind.
Frauen haben ihr kurzfristig verwertbares Vermögen, das über der Vermögensfreigrenze liegt, zur Finanzierung des Schwangerschaftsabbruchs einzusetzen. Bei 1.420 ausgewerteten Anträgen waren nur in neun Fällen Vermögen zwischen 200 € und 800 € angegeben.
Die Höhe der Kostenerstattung des Landes könnte möglicherweise reduziert werden, wenn die Einkommens- und Vermögensverhältnisse korrekt ermittelt werden.
4 Verfahren
Die derzeitige gesetzliche Regelung hat zur Folge, dass
- von den örtlichen Krankenkassen nicht beurteilt werden kann, ob die von den Antragstellerinnen angegebenen wirtschaftlichen Verhältnisse der Wahrheit entsprechen, da Belege nicht zwingend vorgelegt werden müssen,
- eine Täuschung nicht auszuschließen ist, weil für den Antrag auf Kostenübernahme kein Identitätsnachweis erbracht werden muss,
- ausschließlich dem Arzt oder der Einrichtung, die den Schwangerschaftsabbruch vornimmt, bekannt ist, ob die Voraussetzungen des § 218a Abs. 1 Strafgesetzbuch - wonach mindestens drei Tage vor dem Eingriff eine Schwangerschaftskonfliktberatung stattgefunden haben muss und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sein dürfen - erfüllt sind,
- nicht sichergestellt ist, dass das Land nur die Kosten für Schwangerschaftsabbrüche nach § 218a Abs. 1 Strafgesetzbuch erstattet, da eine entsprechende Bestätigung von den Ärzten bzw. den Einrichtungen nicht gefordert wird und
- sich die Prüfung des Kostenerstattungsanspruches durch das Regierungspräsidium lediglich auf Plausibilitätskontrollen beschränken kann, da das Abrechnungsverfahren anonymisiert durchgeführt wird.
5 Beobachtungspflicht des Gesetzgebers
Obwohl das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung im Jahr 1992 u. a. ausgeführt hat, dass das ungeborene Leben von Verfassung wegen geschützt sei und insbesondere der Schwangerschaftsabbruch nicht ein Instrument der Familienplanung sein dürfe, werden bis heute statistische Daten zu wiederholten Schwangerschaftsabbrüchen einer Frau nicht gefordert.
Von den 8.039 vom Rechnungshof erfassten Frauen, die im Jahr 2006 einen Schwangerschaftsabbruch durchführen ließen, erfolgte bei 182 (2,3 %) Frauen ein Abbruch insgesamt zweifach und bei 4 Frauen dreifach im selben Jahr. Betrachtet man den Zeitraum von 2000 bis 2006, haben aus diesem Personenkreis 1.407 Frauen mehrfach, in Einzelfällen bis zu neunmal, Schwangerschaftsabbrüche vornehmen lassen. Insgesamt 18,8 % der Frauen haben innerhalb von sieben Jahren mehr als einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, für den das Land aufkam.
6 Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs
Im Jahr 2006 betrug die Kostenerstattung des Landes, einschließlich der Verwaltungskosten der Krankenkassen, 5,2 Mio. €. Die durchschnittlichen Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs lagen bei 445 €. Die Kosten für einen Schwangerschaftsabbruch in Baden-Württemberg sind deutlich höher als im Freistaat Bayern. Die dortige Kostenpauschale von durchschnittlich 322 € auf Baden-Württemberg übertragen, ergäbe eine Kostenerstattung von nur 3,8 Mio. € und somit ein Einsparungspotenzial von 1,4 Mio. €.
Nicht alle für einen Schwangerschaftsabbruch vom Land erstatteten Kosten entfallen auf Leistungen, die unmittelbar die Vornahme des Abbruchs betreffen. Teilweise sind die abgerechneten Leistungen und Kosten nicht plausibel, weil z. B. die Ultraschalluntersuchung oder der Ordinations- und Konsultationskomplex nicht unmittelbar dem Schwangerschaftsabbruch zugeordnet werden können. Außerdem fordert das derzeitige Abrechnungssystem von allen Beteiligten einen hohen Verwaltungsaufwand.
7 Empfehlungen
Die Untersuchungsergebnisse geben Anlass zu Änderungen im Abrechnungssystem und im Verfahren. Der Rechnungshof empfiehlt,
- Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass den gesetzlichen Krankenkassen eine schlüssige Dokumentation über einen straffreien Schwangerschaftsabbruch vorzulegen ist, um die Rechtmäßigkeit ihrer Zahlung sowie die Kostenerstattung durch die Bundesländer prüfbar zu machen,
- Mehrfachabbrüche der Antragstellerinnen als Erhebungsmerkmal in § 16 Abs. 1 Schwangerschaftskonfliktgesetz aufzunehmen, um der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Beobachtungs- und Nachbesserungspflicht zu genügen und
- auf dem Verhandlungsweg eine Pauschale für die Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs festzulegen, um den Verwaltungsaufwand der Ärzte, der gesetzlichen Krankenkassen und der Kosten erstattenden Stelle zu vermindern. Bei Festlegung einer solchen Pauschale wäre insbesondere zu berücksichtigen, dass nur solche Leistungen einbezogen werden, die unmittelbar dem Schwangerschaftsabbruch zuzuordnen sind. Dies könnte nach dem Bayern-Modell landesintern gelöst werden. Die Chancen einer bundeseinheitlichen Lösung sollten abgeklärt werden.
8 Stellungnahme des Ministeriums
Das Ministerium für Arbeit und Soziales betonte, dass ihm an einer möglichst zielgenauen Abrechnung der Erstattungsfälle gelegen sei. So habe es bereits erste Gespräche gegeben, um mögliche Verfahrensoptimierungen auszuloten. In einem nächsten Schritt wolle das Ministerium mit der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg und Vertretern aus der Ärzteschaft Gespräche über die Vereinbarung von Pauschalen führen. Allerdings könnten die Ärzte nach geltendem Recht nicht verpflichtet werden, pauschal abzurechnen. Die Akzeptanz einer Pauschale sei nur zu erwarten, wenn sich die Höhe der Vergütung an dem orientiere, was der Einheitliche Bewertungsmaßstab (EBM) für die Vergütung medizinisch indizierter Schwangerschaftsabbrüche vorsehe. Die Kostenerstattung ließe sich nicht auf das in Bayern festgelegte finanzielle Niveau ausrichten, da die dort festgelegten Punktwerte deutlich niedriger als in Baden-Württemberg seien. Demzufolge werde es nicht gelingen, ein deutliches Einsparpotenzial zu erzielen. Selbst wenn die bayerische Pauschale in Baden-Württemberg durchsetzbar wäre, ergäbe sich ein hypothetisches Einsparpotenzial von knapp 600.000 €. Auch sehe das Ministerium keine Möglichkeit, auf die Erhebungsmerkmale für die statistische Auswertung Einfluss zu nehmen (Erhebung der Mehrfachabbrüche). Eine Gesetzesänderung könne nur durch den Bund erfolgen.
9 Schlussbemerkung
Der Rechnungshof teilt aufgrund seiner Prüfungsergebnisse nicht die Einschätzung des Ministeriums für Arbeit und Soziales, dass eine Pauschalierung der Vergütung für einen Schwangerschaftsabbruch zu keinem deutlichen Einsparpotenzial führen würde.
Durch eine Pauschalierung könnte vielmehr nicht nur das Verfahren vereinfacht, sondern auch die Kosten gesenkt werden.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Einzelplan 12: Allgemeine Finanzverwaltung
Die Arbeitslage der Finanzämter bei der Prüfung von Kleinbetrieben hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend verschlechtert. Operative Verbesserungen sind erforderlich. Ein weiterer Personalabbau in diesem Bereich sollte vermieden werden.
1 Einführung
Die Außenprüfung ist ein besonderes Verwaltungsverfahren zur Erfüllung der den Finanzämtern obliegenden Aufgabe, die Steuern nach Maßgabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen. Die Amtsbetriebsprüfung ist Teil dieser Außenprüfung. Den Amtsbetriebsprüfungs-Stellen obliegt die Prüfung der gewerblichen sowie der land- und forstwirtschaftlichen Klein- und Kleinstbetriebe , während die Mittel- und Großbetriebe von den Betriebsprüfungs-Hauptstellen geprüft werden. Daneben führt die Amtsbetriebsprüfung in Fällen, bei denen keine regelmäßige Prüfung notwendig scheint, sogenannte abgekürzte Außenprüfungen durch. Bei jedem Veranlagungsfinanzamt des Landes sind Amtsbetriebsprüfungs-Stellen eingerichtet.
2 Umfang und Inhalt der Erhebungen
Der Rechnungshof hat in den vergangenen Jahren die Organisation und Arbeitsweise verschiedener Fachbereiche der Finanzämter untersucht, darunter nahezu sämtliche Prüfungsdienste . Die Arbeitsweise der Amtsbetriebsprüfung wurde bisher noch nicht näher betrachtet.
In die Erhebungen wurden insgesamt 14 Finanzämter einbezogen.
3 Feststellungen
3.1 Materiell-rechtliche Untersuchung
Die materiell-rechtliche Untersuchung durch die Finanzkontrolle umfasste rd. 800 Steuerfälle, bei denen zuvor eine Außenprüfung durch die Amtsbetriebsprüfung erfolgt war. Bei diesen Außenprüfungen wurden Mehrsteuern von insgesamt 4,8 Mio. € erzielt.
Die Untersuchung der Finanzkontrolle ergab - soweit dies nach Aktenlage erkennbar war -, dass 10,3 % der Fälle fehlerhaft bearbeitet worden waren. Allerdings bezifferten sich die finanziellen Auswirkungen dieser Fehler nur auf rd. 117.000 €. Bezogen auf die gesamten Mehrsteuern entspricht dies lediglich einem Anteil von knapp 2,4 %.
3.2 Personalausstattung
Wie sich die tatsächliche Personalausstattung im Vergleich zu den Sollvorgaben ab dem Jahr 2004 entwickelt hat, ist der Abbildung zu entnehmen.
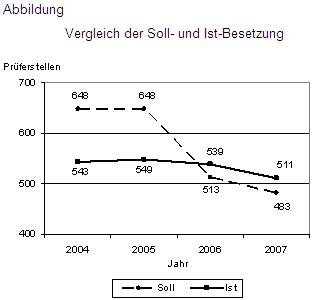
Die Ist-Besetzung lag bis zum Jahr 2005 unter dem Sollwert. Erst nach einer Minderung der Sollbesetzung zum 01.01.2006 um mehr als 20 % und einer weiteren Reduzierung um nochmals 30 Stellen zum 01.01.2007 ist nunmehr ein rechnerischer Überbestand vorhanden. Auch in den kommenden Jahren ist beabsichtigt, das Prüfersoll um jährlich 30 Stellen zu mindern. Es bestehen Zweifel, ob sich die Ermittlung der Sollzahlen an den Erfordernissen der Amtsbetriebsprüfung orientierte oder pauschale Vorgaben zum Personalabbau umgesetzt wurden.
3.3 Zahl der zu prüfenden Betriebe
Die Zahl der von der Amtsbetriebsprüfung zu prüfenden Betriebe hat sich in den Jahren 2002 bis 2006 landesweit um 44.000 (+5,5 %) erhöht. Die Kleinbetriebe haben sich von rd. 120.000 auf rd. 105.000 (-12,2 %) vermindert, wohingegen sich die Zahl der Kleinstbetriebe im selben Zeitraum von rd. 680.000 auf rd. 739.000 (+8,7 %) erhöhte.
3.4 Prüfungsturnus
In der Tabelle 1 wird der landesweite Prüfungsturnus dargestellt, aus dem sich ablesen lässt, in welchen durchschnittlichen Zeitabständen ein Betrieb geprüft wird.
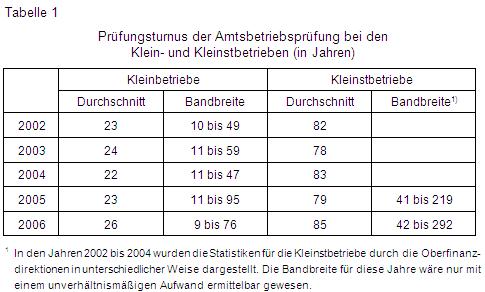
Der Prüfungsturnus hat sich in beiden Größenklassen verschlechtert. Auffällig ist insbesondere, dass die Bandbreite zwischen den Finanzämtern erheblich größer geworden ist.
Ein Vergleich mit den Prüfungsintervallen früherer Jahre verdeutlicht die Dimension der Entwicklung. In den Jahren 1991 und 1992 betrug der Turnus bei den Kleinbetrieben noch jeweils 17 Jahre und bei den Kleinstbetrieben 29 bzw. 36 Jahre. Vor dem Hintergrund dieser - aus heutiger Sicht günstigen - Intervalle hatte der Landtag im Jahr 1993 die Landesregierung ersucht, „der Wiederherstellung der Steuergerechtigkeit in Baden-Württemberg höchste Priorität einzuräumen und … einen Stufenplan vorzulegen, wie bis 1998 die durchschnittlichen Betriebsprüfungsintervalle bei … Klein- und Kleinstbetrieben auf 10 Jahre gesenkt werden können …“ . Die Realität hat sich von diesen Vorstellungen inzwischen sehr weit entfernt. Selbst unter der Annahme, dass etwa die Hälfte der Kleinstbetriebe nicht prüfungswürdig ist , liegt kein annähernd befriedigender Turnus vor. Die Vorgaben des Landtags zur Gleichmäßigkeit der Besteuerung werden damit bei weitem nicht erreicht.
3.5 Finanzielle Ergebnisse
Die seit 2002 insgesamt und je Prüfer festgesetzten Mehrsteuern sind in Tabelle 2 aufgeführt. Ergänzend werden die Werte dargestellt, um die die Amtsbetriebsprüfung die in künftige Jahre vortragsfähigen Verluste gekürzt hat (Verlustkürzungen).
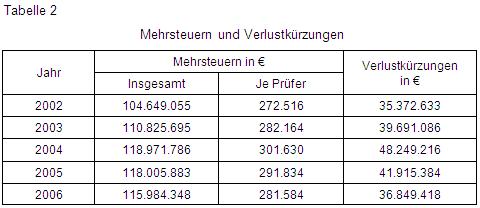
Die landesweit festgesetzten Mehrsteuern sind relativ konstant, dies gilt auch für den Durchschnittsbetrag je Prüfer. Welche Mehrsteuern letztlich aus den Verlustkürzungen resultieren werden, kann nicht vorhergesagt werden. Nach Einschätzung des Rechnungshofs erscheint es aber realistisch, von zusätzlichen Mehrsteuern in Höhe von 25 % der Verlustkürzungen auszugehen.
3.6 Realisierung der ermittelten Mehrsteuern
Die Untersuchung bei den geprüften Finanzämtern hat gezeigt, dass die von der Amtsbetriebsprüfung ermittelten Mehrsteuern mindestens zu 80 % realisiert wurden. Dieser Anteil ist höher als z. B. bei der Steuerfahndung oder der Umsatzsteuer-Prüfung . Zu berücksichtigen ist auch, dass es sich bei den Ergebnissen der Amtsbetriebsprüfung im Wesentlichen nicht um Verlagerungen in andere Veranlagungszeiträume, sondern um echte Mehrsteuern handelt.
3.7 Zahl der Prüfungen
3.7.1 Gesamtzahl der Prüfungen
Während im Jahr 2005 noch rd. 18.500 Prüfungen durchgeführt wurden, waren es im Jahr 2006 nur noch rd. 17.200 Prüfungen, was einen Rückgang von 7,1 % bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnittswert der vorangegangenen sechs Jahre hat die Zahl der Prüfungen sogar um 7,7 % abgenommen.
3.7.2 Anteil der abgekürzten Außenprüfungen
Abgekürzte Außenprüfungen dienen der Klärung einzelner zweifelhafter Sachverhalte und betreffen in der Regel punktuell eine Besteuerungsgrundlage.
Der Anteil der abgekürzten Außenprüfungen unterlag in den letzten Jahren relativ hohen Schwankungen, zuletzt erhöhte sich der Anteil von knapp 30 % im Jahr 2005 auf mehr als 36 % im Jahr 2006. Auffallend ist hierbei die erhebliche Bandbreite bei den einzelnen Finanzämtern. So variiert der Anteil an abgekürzten Außenprüfungen im Jahr 2006 zwischen 11,4 % und 65,9 %.
3.8 Mehrergebnis je Prüfung
Das durchschnittliche Mehrergebnis je Prüfung hat sich seit 2000 von 5.760 € um 19 % auf 6.860 € im Jahr 2006 erhöht. Allerdings ist dabei zwischen Vollprüfungen und abgekürzten Außenprüfungen zu differenzieren. Während das durchschnittliche Mehrergebnis bei abgekürzten Außenprüfungen relativ konstant bei 5.000 € blieb, ist dieser Wert bei den Vollprüfungen um 24,6 % auf 7.700 € angestiegen.
3.9 Fälle ohne steuerliches Mehrergebnis
Bei mehr als einem Viertel aller Prüfungen handelt es sich um sogenannte Nullfälle. Bezogen auf die Vollprüfungen betrug die Nullfallquote zuletzt 24,7 %, bei den abgekürzten Außenprüfungen lag dieser Wert bei 36,4 %.
3.10 Fälle mit Verdacht einer Steuerstraftat
Der Anteil der Fälle, bei denen der Verdacht einer Steuerstraftat bestand, hat sich seit 2000 kontinuierlich erhöht und mit einem Anteil von 6,3 % im Jahr 2006 fast verdoppelt. Die Bearbeitung dieser Fälle erforderte im Vergleich zu den übrigen Fällen durchschnittlich den zweifachen Zeitaufwand. Allerdings betrugen die Mehrergebnisse ein Vielfaches dessen, was bei den übrigen Prüfungsfällen erzielt wurde.
4 Kosten-Nutzen-Betrachtung
Die Finanzbehörden haben die Steuern nach Maßgabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben und grundsätzlich alle für den Einzelfall bedeutsamen Umstände zu berücksichtigen. Hierbei ist jedoch stets der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Das Ergebnis einer möglichst gleichmäßigen und korrekten Besteuerung ist daher nicht um jeden Preis herbeizuführen, sondern es muss zudem auf das Verhältnis des voraussichtlichen Arbeitsaufwandes zum steuerlichen Erfolg abgestellt werden. Diese Vorgaben sind auch von den Amtsbetriebsprüfungs-Stellen zu beachten.
Der Rechnungshof hat sich deshalb mit der Frage beschäftigt, in welcher Relation die Kosten der Amtsbetriebsprüfung zu ihrem fiskalischen Nutzen stehen, wobei der Nutzen ausschließlich auf das erzielte finanzielle Mehrergebnis reduziert wurde. Ausgeblendet wurden insoweit die weiteren wichtigen Aufgaben, präventiv zu wirken und die Gleichmäßigkeit der Besteuerung sicher zu stellen.
Ausgehend von der Personalbesetzung zum 01.01.2006 betragen die Personal- und Sachkosten zusammen 37,1 Mio. €. Der Nutzen belief sich im Jahr 2006 auf rd. 92,8 Mio. € . Der fiskalische Nutzen der Amtsbetriebsprüfung liegt somit rd. 2,5-fach höher als deren Kosten.
Dabei ist zu beachten, dass sich der so definierte Nutzen auf den Bund, das Land, die anderen Bundesländer und die Kommunen verteilt, während die Kosten das Land allein trägt. Dieser Effekt darf jedoch aus Rechtsgründen nicht ausschlaggebend sein für die Art des Vollzugs.
5 Ergebnisse und Vorschläge
5.1 Zusammenfassende Bewertung
Die Tätigkeit der Amtsbetriebsprüfung ist ertragreich. Die erhobenen zusätzlichen Steuereinnahmen betragen im Durchschnitt das 2,5-fache der entstandenen Personal- und Sachkosten. Soweit es sich nach Aktenlage beurteilen lässt, kann von einer insgesamt guten Arbeitsqualität der Amtsbetriebsprüfung ausgegangen werden.
5.2 Empfehlungen zur Optimierung
Die Arbeitslage hat sich allerdings in den vergangenen Jahren kontinuierlich verschlechtert. Der Prüfungsturnus entspricht nicht annähernd dem Anliegen des Landtags in seinem Beschluss aus dem Jahre 1993 , einen Prüfungsturnus von 10 Jahren für Klein- und Kleinstbetriebe anzustreben. Daran gemessen ist die Gleichmäßigkeit der Besteuerung nicht gewährleistet. Bedenklich sind insbesondere die erheblichen Unterschiede bei den einzelnen Finanzämtern.
Diese Entwicklung wird noch verschärft durch
- die steigende Zahl von Fällen mit Verdacht einer Steuerstraftat,
- eine von allen untersuchten Finanzämtern beschriebene, höhere Konfliktträchtigkeit der Fälle,
- einen erheblichen Anteil von Fällen, bei denen unzureichende Aufzeichnungen und mangelhafte Buchführung die Prüfung erschweren.
Vor dem Hintergrund der Arbeitslage sollte die Landesregierung überprüfen, ob die eingeschlagene Politik der pauschalen Personalkürzung (bis 2010 jährlich 30 Prüfer) angemessen ist. Die Personalpolitik sollte sich nach strategischen Überlegungen richten.
Nach Arbeitslage und derzeitiger Personalausstattung sollte ein weiterer Personalabbau in der Amtsbetriebsprüfung vermieden werden.
5.3 Weitere Vorschläge
Zur weiteren Optimierung der Arbeitsweise hat der Rechnungshof noch im Einzelnen aufgezeigt,
- wie durch eine verbesserte Fallauswahl der Anteil der Nullfälle verringert werden kann,
- dass der Anteil der abgekürzten Außenprüfungen auf etwa ein Drittel begrenzt werden sollte,
- inwieweit die DV-Unterstützung noch verbessert und die Fortbildungsmaßnahmen effektiver gestaltet werden können und
- dass die erkennbaren regionalen Unterschiede beim Anteil der Fälle mit Verdacht einer Steuerstraftat bei der Personalzuweisung berücksichtigt werden sollten.
6 Stellungnahme des Ministeriums
Grundsätzlich keine Einwendungen bestehen zu der Sachdarstellung und der vom Rechnungshof vertretenen Rechtsauffassung.
Allerdings hatte das Finanzministerium im Rahmen des Prüfungsverfahrens einzelne Einwendungen zu den weiteren Vorschlägen (Pkt. 5.3) vorgetragen. Die Erörterungen sind insoweit noch nicht abgeschlossen.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Der Verzicht auf den Versand von Vordrucken für die Einkommensteuererklärung könnte zu Einsparungen von mehr als 1 Mio. € jährlich führen. Durch eine Optimierung des Versands könnten jährlich Kosten von rd. 350.000 € eingespart werden.
1 Ausgangslage
Die Einkommensteuererklärung ist auf amtlich vorgeschriebenem Vordruck abzugeben (§ 150 Abs. 1 Abgabenordnung). Die dazu notwendigen Formulare werden zentral durch die Oberfinanzdirektion beschafft und versandt.
Bürger, die ihre Steuererklärungen mit eigener Steuersoftware selbst erstellen oder auf elektronischem Wege beim Finanzamt abgeben, sollen vom Zentralversand ausgenommen werden. Die hierzu erforderlichen Informationen sind daher bei der Bearbeitung solcher Steuererklärungen im DV-System in Form eines sogenannten Ausschlussmerkers zu hinterlegen. Im Rahmen früherer Prüfungen hat die Finanzkontrolle festgestellt, dass diese Informationen nicht in allen Fällen hinterlegt waren.
Der Versandaktion für den Veranlagungszeitraum 2006 lagen - am unterschiedlichen Bedarf der Bürger orientiert - 94 verschiedene Vordrucksätze zugrunde. Insgesamt wurden 1,55 Mio. Vordrucksätze versandt. Die Kosten für den Druck und den Versand beliefen sich auf rd. 1,8 Mio. €.
2 Feststellungen des Staatlichen Rechnungsprüfungsamts Karlsruhe
Die Untersuchung erstreckte sich auf 1.872 Versandfälle bei acht repräsentativ ausgewählten Finanzämtern. Daneben wurden die maßgeblichen landesweiten Datenbestände der Finanzverwaltung ausgewertet.
2.1 Fehlender Ausschlussmerker im DV-System
Bei 12 % der untersuchten Versandfälle hätte ein Ausschluss vom Zentralversand erfolgen müssen, weil die zuletzt durchgeführte Veranlagung nicht auf dem amtlichen Vordruck abgegeben worden war. Eine Information im DV-System, die dies verhindern soll, fehlte. Hochgerechnet auf die Gesamtzahl der Versandfälle hätte deshalb in rd. 180.000 Fällen auf den Versand der Vordrucksätze verzichtet werden können.
Bei durchschnittlichen Kosten für Druck und Versand von insgesamt rd. 1 € je Fall hätten bei einem konsequenten Ausschluss aller geeigneten Fälle Kosten in Höhe von 180.000 € eingespart werden können.
2.2 Zentralversand trotz Ausschlussmerker im DV-System
In weiteren 26.000 Fällen waren die für einen Ausschluss vom Zentralversand notwendigen Informationen zwar im DV-System vorhanden, allerdings nur für das Jahr 2004, weil die Steuerveranlagung für das Jahr 2005 noch nicht durchgeführt worden war. Die DV-Programme haben in diesen Fällen nicht, wie vorgesehen, auf die Daten der Veranlagung 2004 zurückgegriffen. Ein möglicher Ausschluss vom Zentralversand ist daher unterblieben. Bei durchschnittlichen Kosten von rd. 1 € je Fall hätten bei einem Ausschluss dieser Fälle weitere 26.000 € eingespart werden können.
2.3 Unnötiger Versand von Anlagen
In allen 1,55 Mio. Fällen des Zentralversands waren den Vordrucksätzen jeweils vier Einzelvordrucke der Anlage „Kind“ beigefügt. Tatsächlich waren im Veranlagungszeitraum 2005 jedoch lediglich in rd. 550.000 Fällen Kinder zu berücksichtigen. Somit wurden im Zentralversand rd. 1 Mio. Fälle mit insgesamt 4 Mio. Vordrucken der Anlage „Kind“ versorgt, obgleich kein Bedarf bestand. Dadurch wurde ein Mehraufwand von 87.000 € verursacht.
Auch die Anlage zur Erklärung von sonstigen Einkünften (SO) ist in den Vordrucksätzen jeweils in vierfacher Ausfertigung enthalten. Gründe für die vier Anlagen je Vordrucksatz sind nicht ersichtlich. Durch eine bedarfsgerechte Reduzierung des Zentralversands auf jeweils zwei dieser Anlagen können weitere Kosten von 40.000 € eingespart werden.
Die Förderung der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung nach § 10e Einkommensteuergesetz war mittels der speziellen Anlage FW zu beantragen. Damit in Förderfällen dem Vordrucksatz diese Anlage nebst einer schriftlichen Anleitung beigefügt werden konnte, war die hierzu erforderliche Information von den Finanzämtern im DV-System abzulegen. Nach Ablauf des achtjährigen Förderzeitraums war diese Information zu löschen. Die Erhebungen ergaben, dass insgesamt mehr als 600.000 Vordrucke der Anlage FW ohne Bedarf versandt wurden. Kosten von 9.000 € hätten gespart werden können.
2.4 Verfahrensweise anderer Bundesländer
In den vergangenen Jahren haben andere Bundesländer auf den Versand der Steuererklärungsvordrucke verzichtet. Neben den Stadtstaaten waren dies Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen und Schleswig-Holstein. In Pressemitteilungen wurden die Steuerbürger über die künftige Verfahrensweise informiert. Diese wurde z. B. in Rheinland-Pfalz mit Einsparungen von 500.000 € begründet. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die zeitnahe Versorgung der Steuerbürger mit Erklärungsvordrucken sichergestellt sei. Die Vordrucke seien unter anderem bei den Kommunalverwaltungen ausgelegt. Zudem wurde insbesondere auch auf die Verfügbarkeit der Vordrucke im Internet und auf die Möglichkeit der elektronischen Abgabe der Steuererklärung hingewiesen.
3 Bewertung und Empfehlungen
3.1 Verzicht auf den Zentralversand
Die Versandkosten von mehr als 1 Mio. € sollten Anlass geben zu prüfen, ob Baden-Württemberg auf den Zentralversand verzichten kann. Die Beispiele anderer Bundesländer zeigen, dass eine orts- und zeitnahe Versorgung der Bürger mit den erforderlichen Vordrucken auch bei einem Verzicht auf den Zentralversand gewährleistet ist. Schon heute liegen die Vordrucke in den Finanzämtern und teilweise auch bei den Gemeinden aus.
Dieser Verzicht dürfte im Übrigen wohl auch bewirken, dass Steuerbürger ihre Einkommensteuer vermehrt im ELSTER-Verfahren (elektronische Steuererklärung) erklären. Die Steigerung der ELSTER-Quote ist ein vorrangiges Ziel der Verwaltung, um Bearbeitungsaufwand bei den Finanzämtern einzusparen und Fehler durch Medienbrüche zu vermeiden.
3.2 Optimierungsmöglichkeiten
Sollte die Landesverwaltung aus Gründen des Bürgerservice an einem zentralen Versand festhalten wollen, bieten sich Optimierungsmöglichkeiten an.
Die von der Steuerverwaltung vorgesehenen Ausnahmen vom Zentralversand sind sinnvoll. Voraussetzung dafür ist allerdings eine sorgfältige Datenpflege im DV-System der Steuerverwaltung. Soweit Steuererklärungen auf amtlichem Vordruck eingereicht und elektronisch in das DV-System eingelesen werden, sollte programmgesteuert sichergestellt werden, dass ein Versandmerker im DV-System gesetzt wird. Alle übrigen Fälle sollten automatisch mit einem Ausschlussmerker gekennzeichnet werden.
Noch während des Prüfungsverfahrens hat die Verwaltung den Vorschlag der Finanzkontrolle umgesetzt, die Anzahl der Anlagen SO von vier auf zwei Anlagen zu reduzieren.
In Steuerfällen, bei denen in der letzten Veranlagung keine Kinder zu berücksichtigen waren, sollte - zumindest bei den drei wichtigsten Vordrucksätzen - auf die Beifügung der Anlagen „Kind“ verzichtet werden; auf diese drei Vordrucksätze entfallen 80 % der Versandfälle.
Hinsichtlich des Versands der Anlage FW lässt die Auswertung der Datenbestände darauf schließen, dass der Datenpflege bisher zu wenig Bedeutung beigemessen wurde. Bei der nächsten Versandaktion sollte konsequent auf die aktuellen Daten der letzten Einkommensteuerveranlagung abgestellt werden.
4 Stellungnahme des Ministeriums
Das Finanzministerium betrachtet den Versand der Vordrucke für die Steuererklärung als Bürgerservice, der beibehalten werden sollte. Gleichwohl habe es die Oberfinanzdirektion gebeten, vor einer neuen Ausschreibung der Versanddienstleistung zu untersuchen, ob die Fortführung des Zentralversands sinnvoll ist. Allerdings sei die Steuerverwaltung insoweit noch bis 2010 vertraglich gebunden. Die Empfehlungen zur Optimierung des Zentralversands seien bereits weitgehend umgesetzt worden.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Für den Umbau und die Modernisierung der Universitätsbibliothek Freiburg sind Baukosten in Höhe von 44 Mio. € vorgesehen. Bei wirtschaftlicherer Planung hätten 8 Mio. € Baukosten eingespart werden können. Bei künftigen Architektenwettbewerben sollte das Land darauf achten, dass wirtschaftlichen Aspekten mehr Gewicht eingeräumt wird.
1 Ausgangslage
Die Universitätsbibliothek Freiburg muss wegen verschiedener Mängel nach 30-jähriger Betriebszeit saniert und modernisiert werden. Eine Projektstudie der Bauverwaltung aus dem Jahr 2004 kam zu dem Ergebnis, dass eine kleine Lösung, die die bauliche und gebäudetechnische Grundstruktur beibehält und zu 15 % Energieeinsparung führt, mit 40 Mio. € ebenso viel koste wie eine große Lösung mit umfangreichen Eingriffen in Konstruktion und Fassade sowie einer Energieeinsparung von 50 %.
Auf der Grundlage dieser Projektstudie entschied sich das Land für die große Umstrukturierungslösung und lobte im Dezember 2005 einen Architektenwettbewerb aus.
2 Der Architektenwettbewerb
2.1 Aufgabenstellung
In der Ausschreibung wurde die Aufgabe gestellt, die Bibliothek städtebaulich, architektonisch und organisatorisch den geänderten Bedingungen anzupassen und die Bedeutung als modernes Informations- und Kommunikationszentrum hervorzuheben.
Ein wesentlicher Teil der Wettbewerbsaufgabe bestand darin, das oberirdische Gebäudevolumen zu reduzieren und die Eingangssituation in das Erdgeschoss neu zu gestalten. Die Tiefmagazine im 2. und 3. Untergeschoss wurden von der Sanierung ausgenommen und sollen während des Umbaus weiter in Betrieb bleiben. Der Energieverbrauch sollte um 50 %, die Betriebskosten sollten um 30 % reduziert werden. Die Struktur des Gebäudes war so zu gestalten, dass möglichst große Bereiche natürlich belüftet werden können. Der Glasflächenanteil sollte aus klimatischen und belichtungstechnischen Gründen möglichst 40 % bis 60 % betragen.
Als funktionelles Ziel war vorgegeben, dass das Gebäude künftig als 24-Stunden-Bibliothek mit weitgehend offenen Magazinen genutzt werden kann. Die Stadt Freiburg erwartete von dem Wettbewerb städtebauliche Impulse: Es sollte eine „kulturelle Mitte“ in der Stadt entstehen, deren Atmosphäre und Wirkung über die reine Funktionserfüllung hinausgeht.
Die wirtschaftliche Vorgabe für den Wettbewerb lautete: „Die Gesamtbaukosten von 40 Mio. € sind zwingend einzuhalten.“
2.2 Die Entscheidung des Preisgerichts
Das Preisgericht wählte als ersten Preis einen Entwurf, der zwar architektonisch anspruchsvoll ist und die Vorgaben für den künftigen Bibliotheksbetrieb erfüllt, aber auch am aufwendigsten und am weitesten von dem ursprünglichen Planungskonzept entfernt ist. Als voraussichtliche Baukosten wurden bereits beim Wettbewerbsentwurf 43 Mio. € genannt.
Der erste Preisträger wurde mit der weiteren Planung beauftragt.
3 Kritik des Rechnungshofs
3.1 Unwirtschaftlichkeit der geplanten Sanierung
Das Preisgericht hat bei seiner Bewertung der Wettbewerbsentwürfe städtebaulichen und gestalterischen Gesichtspunkten den Vorrang gegeben. Die in der Auslobung festgelegten Beurteilungskriterien zu Investitions- und Folgekosten sowie zur Wirtschaftlichkeit wurden vernachlässigt, obwohl die Vorprüfung auf Defizite im energetischen Bereich hingewiesen hatte.
Der auf Empfehlung des Preisgerichts beauftragte Entwurf des ersten Preisträgers führt mit seiner aufwendigen Fassade und insbesondere durch seine starken Eingriffe in die vorhandene Tragkonstruktion zu erhöhten Baukosten. Das ursprüngliche Sanierungskonzept, nämlich durch natürliche Belichtung und Belüftung Technik- und damit Betriebskosten einzusparen, kann mit dem Entwurf nicht optimal umgesetzt werden.
Wesentliche mit der Sanierung angestrebte Ziele, nämlich eine Öffnung nach außen, möglichst große natürlich zu belüftende Bereiche und weitgehende Tageslichtautonomie, werden nur unzureichend oder gar nicht erreicht. Die Vorgaben zur energetischen Optimierung sind damit nicht oder nur mit erhöhtem technischen Aufwand umsetzbar. Zudem bedeuten die erforderlichen starken Eingriffe in die Konstruktion, dass sich die baulichen Veränderungen bis in die eigentlich auszusparenden Tiefgeschosse erstrecken.
Bedenklich ist schließlich, dass bei dieser Sanierung erhebliche Investitionsmittel eingesetzt werden, um vorhandene Gebäudesubstanz im Wert von rd. 10 Mio. € zu vernichten. Ein Entwurf, der darauf verzichtete, hätte der Universität ein erhebliches Flächenpotenzial erhalten. Für die Auslagerung der Außenstelle des Universitätsrechenzentrums werden Flächen in einem von der Liegenschaftsverwaltung neu angekauften Verwaltungsgebäude beansprucht.
Die dem Finanzministerium nunmehr vorliegende Bauunterlage schließt mit 44 Mio. € Gesamtbaukosten ab. Rechnet man zu dieser Summe die Kosten für die vorbereitenden Maßnahmen und die nicht veranschlagten Kosten der Ausstattung hinzu, ergibt sich ein Gesamtaufwand von rd. 50 Mio. €. Damit wird die geplante Sanierung einen Aufwand verursachen, der mehr als 60 % der vergleichbaren Neubaukosten erreicht und der die Kostenobergrenze der Wettbewerbsaufgabe deutlich überschreitet.
Nach Berechnungen des Rechnungshofs wären auf der Grundlage der Aufgabenstellung und bei Anlegen vernünftiger Sanierungsmaßstäbe Gesamtbaukosten von 36 Mio. € ausreichend, um die Ziele der Sanierung zu erreichen. Die Differenz von 8 Mio. € zu den jetzt veranschlagten Baukosten beruht im Wesentlichen auf Einsparungen beim Rückschnitt der Geschossdecken und der statischen Ertüchtigung (2,9 Mio. €), bei der Konstruktion der Fassade (3,0 Mio. €), bei der Gestaltung der Außenanlagen (0,6 Mio. €) und den entsprechenden Einsparungen bei den Baunebenkosten.
3.2 Risiken der geplanten Baudurchführung, Alternativen
Das Finanzministerium hat sich für eine konventionelle haushaltsfinanzierte Realisierung der Sanierungsmaßnahme entschieden. Diese Baudurchführung lässt einen erhöhten Koordinierungs- und Begleitungsaufwand erwarten. Außerdem sind nach den Prüfungserfahrungen des Rechnungshofs dabei Kostenrisiken durch Nachträge und Änderungen zu erwarten.
Mit der frühzeitigen Festlegung auf die Umsetzung des preisgekrönten Entwurfs nutzt die Verwaltung nicht die Wirtschaftlichkeitsvorteile, die ein Investor auf der Grundlage einer funktionalen Ausschreibung erzielen könnte. Insbesondere die Einbeziehung der späteren baulichen Unterhaltung und der Energieversorgung in sein Angebot würde zu wirtschaftlicheren Konstruktionen und energetisch optimierten technischen Anlagen führen.
4 Empfehlung des Rechnungshofs
Der Rechnungshof hat deshalb empfohlen,
- von der Realisierung des im Wettbewerb ausgewählten Entwurfs abzusehen und eine wirtschaftlichere Planung in Auftrag zu geben,
- das Sanierungsprojekt mit funktionaler Leistungsbeschreibung im Wege einer alternativen Ausschreibung (sogenannte A-B-C-Ausschreibung) in den Wettbewerb zu geben und dabei den Bauunterhalt sowie den technischen Gebäudebetrieb optional auszuschreiben und
- bei künftigen Architektenwettbewerben den Vorgaben zur Wirtschaftlichkeit mehr Gewicht zu geben.
Ein Preisträger, dessen Entwurf von wesentlichen wirtschaftlichen Kriterien der Auslobung abweicht, darf nicht beauftragt werden.
5 Stellungnahme des Ministeriums
Das Finanzministerium weist in seiner Stellungnahme darauf hin, dass sich die vom Rechnungshof vorgebrachten Anregungen und Kritikpunkte auf einen inzwischen überholten Planungsstand beziehen. Die Planung sei in wesentlichen Punkten weiterentwickelt worden, die Kosten lägen damit bei 41 % vergleichbarer Neubaukosten bzw. bei 70 %, wenn die von der Umbaumaßnahme wenig tangierten Tiefgeschosse bei der Berechnung unberücksichtigt blieben.
Auch das Technik-Konzept sei wesentlich weiterentwickelt worden. Das Ziel einer rein natürlichen Belüftung werde bei den Büro- und Verwaltungsbereichen voll erreicht. Dagegen müssten die Bibliotheksbereiche aus Gründen der Behaglichkeit und Wirtschaftlichkeit mechanisch belüftet werden.
Die Einsparauflage von 50 % beim Energieverbrauch im späteren Betrieb würde mit der aktuellen Planung mehr als erfüllt, bei den Betriebskosten werde mit einem Einsparpotenzial von 40 % die Vorgabe des Wettbewerbs ebenfalls übertroffen.
Durch das Entfernen der energetisch problematischen und nutzungstechnisch ungünstigen zerklüfteten Vor- und Rücksprünge in den Fassaden werde die Voraussetzung für eine (energie-) effiziente Ertüchtigung der Gebäudehülle geschaffen. Die vom Rechnungshof geforderte Nutzung der vorhandenen Gebäudesubstanz sei durch die Weiterentwicklung der Planung sichergestellt.
Mit der notwendigen baulichen und technischen Ertüchtigung werde die Chance genutzt, die nutzungsspezifischen Mängel sowie den architektonischen und städtebaulichen Missstand der Universitätsbibliothek zu beseitigen und sie zukunftsfähig neu zu organisieren. Der Lösungsansatz des Rechnungshofs einer „bestandsnahen Sanierung“ greife zu kurz und sei finanziell nicht stimmig.
Die Durchführung der Sanierung im Rahmen einer Investorenmaßnahme sei nicht sinnvoll, da die für eine derartige Vergabe erforderlichen wesentlichen Umsetzungs- und Gestaltungsspielräume nicht gegeben seien.
6 Schlussbemerkung
Nach Einschätzung des Rechnungshofs wären auf der Grundlage der Aufgabenstellung und bei Anlegen vernünftiger Sanierungsmaßstäbe Gesamtbaukosten von 36 Mio. € ausreichend gewesen.
Auf den vom Rechnungshof kritisierten Flächenverlust, der kompensiert werden muss, ist das Finanzministerium in seiner Stellungnahme nicht eingegangen.
Positiv zu bewerten ist, dass die Verwaltung Kritik und Anregungen aufgegriffen und den Wettbewerbsentwurf grundlegend überarbeitet hat. Dennoch bleibt der Rechnungshof dabei, dass die Ziele der baulichen und technischen Sanierung der Universitätsbibliothek, nämlich bei hohen gestalterischen Anforderungen eine funktional optimale Lösung für den Bibliotheksbetrieb zu schaffen und gleichzeitig eine Senkung der künftigen Energie- und Betriebskosten zu erreichen, mit einem deutlich geringeren Kostenaufwand erreichbar gewesen wären.
Der Rechnungshof hält an seiner Auffassung fest, dass eine Realisierung des Projekts auch durch einen Investor möglich ist. Er schlägt deshalb vor, das Projekt alternativ auszuschreiben.
Bei künftigen Architektenwettbewerben müssen die Gebote von Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Nachhaltigkeit stärker als verbindliche Bewertungskriterien festgelegt und bei den Entscheidungen auch beachtet werden. Dazu sollten zur energetischen Bewertung der Entwürfe sachverständige Berater im Preisgericht mitwirken. Bei der Entscheidung über die Beauftragung muss die Einhaltung der bei der Wettbewerbsauslobung vorgegebenen Kriterien eine wesentliche Rolle spielen.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Das technische Gebäudemanagement innerhalb des Landesbetriebs Vermögen und Bau kann optimiert werden. Beachtliche Einsparpotenziale ergeben sich durch eine Verbesserung der Wärmedämmung und den Einsatz ressourcenschonender Techniken in den landeseigenen Gebäuden.
1 Vorbemerkung
Die Bewirtschaftung der landeseigenen Immobilien obliegt dem Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, ausgenommen sind lediglich die Universitäten und die Universitätsklinika sowie einige Landesbetriebe.
Obwohl sich die Zahl der bewirtschafteten Gebäude in den letzten Jahren als Folge der Verwaltungsreform reduziert hat, sind die Ausgaben für die Energieversorgung der Dienstgebäude von 57,5 Mio. € im Jahr 2000 um 35 % auf 77 Mio. € im Jahr 2006 gestiegen. Rechnet man den Aufwand der Universitäten und Universitätsklinika hinzu, belaufen sich die gesamten Energiekosten für alle Landesimmobilien im Jahr 2006 auf 164 Mio. €.
Der Rechnungshof und das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Tübingen haben im Jahr 2007 das technische Gebäudemanagement am Beispiel von 70 landeseigenen Gebäuden (Finanzämter und Gerichtsgebäude) geprüft und dabei insbesondere die Energiebeschaffung und das Energiekostenmanagement durch den Landesbetrieb unter die Lupe genommen.
2 Feststellungen
2.1 Energetischer Zustand der Gebäude
Obwohl die Finanzamts- und Gerichtsgebäude im Jahr 2000 von der Hochbauverwaltung speziell untersucht worden waren und danach im Rahmen der vorhandenen Mittel einzelne Verbesserungsmaßnahmen eingeleitet wurden, hat sich bei der Prüfung im Jahr 2007 gezeigt, dass noch immer Potenziale zur Energieeinsparung bestehen. Die Ursachen sind vielfältig: So werden beispielsweise Serverräume zu stark gekühlt, die Betriebszeiten der Heizungsanlagen zu lang eingestellt; die Anlagenleistungen von Heizkesseln sind überdimensioniert, raumlufttechnische Anlagen sind nicht genau genug auf den Bedarf abgestimmt.
Die Mehrzahl der geprüften Gebäude wird konventionell beheizt, d. h. mit Fern- oder Nahwärmeversorgungsanlagen (65 %) oder mit Heizkesselanlagen, die mit Erdgas betrieben werden (35 %). Lediglich 15 % der Heizkessel sind Brennwertkessel. Die technische Wärmedämmung war bei 50 % der geprüften Heizkesselanlagen unvollständig. Keines der geprüften Objekte verfügte über innovative technische Anlagen (Pellet-Heizkessel, Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe, Betonkerntemperierung, Solarthermie, Geothermie oder Regenwassernutzungsanlage). Bisher werden auch keine hocheffizienten Umwälzpumpen eingesetzt.
80 % der geprüften Gebäude haben keinen Vollwärmeschutz, 70 % keine Wärmeschutzverglasung. In 58 % der Gebäude ist die oberste Geschossdecke ungedämmt, obwohl das oberste Geschoss beheizt wird.
Bei den geprüften Gebäuden wurde ein durchschnittlicher jährlicher Wärmeverbrauch von 143 kWh je m² Nettogrundfläche festgestellt. Dieser Verbrauch entspricht dem Standard der Wärmeschutzverordnung von 1984, erfüllt aber bei Weitem nicht die Anforderungen der Energieeinsparverordnung von 2007 (bei derartigen Gebäuden rd. 70 kWh je m² und Jahr).
2.2 Energiemanagement
Für die Lieferung elektrischer Energie führt der Landesbetrieb regelmäßige Sammelausschreibungen durch. Ohne sie lägen die Energiebewirtschaftungskosten noch erheblich höher.
Während die Beleuchtungsanlagen der landeseigenen Gebäude in den letzten Jahren mit gutem Erfolg energetisch optimiert wurden, ist dies für die DV-Anlagen noch nicht geschehen. Sie sind jedoch die wesentlichen Stromverbraucher. Ihr Stromverbrauch macht zwischen 30 % (für hoch installierte Gebäude) und 75 % (in gering installierten Gebäuden) des Gesamtstromverbrauchs aus. Besonders bei den Gerichtsgebäuden wurde festgestellt, dass viele Computer und Drucker außerhalb der Nutzungszeiten im Stand-by-Betrieb laufen und dadurch unnötig elektrische Energie verbrauchen.
Die Möglichkeit, durch eine zentrale Ausschreibung der Erdgaslieferung Kosten zu sparen, wurde nach einem gescheiterten Versuch im Jahr 2002 bislang nicht mehr genutzt. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass teilweise die Erdgas-Bestellleistung über der benötigten Leistungsmenge liegt und dadurch unnötige Kosten entstehen.
Ein Energiecontrolling ist nur in Ansätzen realisiert. Soweit die nutzenden Verwaltungen die Energieverbräuche erfassen, melden sie diese an die Betriebsleitung Vermögen und Bau zur Auswertung. Für 45 % der geprüften Liegenschaften lagen keine monatlichen Verbrauchswerte vor. Ein aussagekräftiges Benchmarking und die Verfolgung langfristiger Sanierungsziele sind vor diesem Hintergrund kaum möglich.
Optimierungen des Anlagenbetriebs konnte der Rechnungshof in keinem der untersuchten Gebäude feststellen.
2.3 Organisation
Die Organisation des technischen Gebäudemanagements in den Vermögens- und Bauämtern ist bisher rein operativ auf die Beschaffung und Abrechnung von Dienstleistungen sowie von Energie ausgerichtet; strategische Zielsetzungen werden kaum berücksichtigt.
Von den rd. 1.700 Mitarbeitern des Landesbetriebs sind weniger als 20 Vollzeitäquivalente dem technischen Gebäudemanagement zuzurechnen. Jeder der in diesem Bereich Beschäftigten betreut zwischen 400 und 600 Gebäude, er arbeitet aber in den meisten Fällen auch im Baumanagement mit und ist zumeist auch für die kaufmännischen und infrastrukturellen Belange zuständig. Bei den einzelnen Vermögens- und Bauämtern ist das Gebäudemanagement unterschiedlich strukturiert und seine Aufgaben sind häufig nicht klar definiert.
Die strategische Aufgabe, die jährlichen Ausgaben in Höhe von 77 Mio. € landesweit zu optimieren, kann mit dieser suboptimalen Organisation und diesem geringen Personaleinsatz nicht erfüllt werden.
3 Empfehlungen
3.1 Organisation
Angesichts der in den nächsten Jahren zu erwartenden weiteren Energiepreissteigerungen kommt dem technischen Gebäudemanagement innerhalb des Landesbetriebs für die Vermögens- und Bauämter eine Schlüsselfunktion zu. Eine zentral bei der Betriebsleitung angesiedelte Stelle sollte für die landesweite Steuerung dieser Aktivitäten eingesetzt werden. Sie sollte auf der Grundlage der Meldungen der Vermögens- und Bauämter Prioritätenlisten erstellen und die Umsetzung der Maßnahmen kontrollieren.
Den nutzenden Verwaltungen sollten verständliche Vergleichsdaten an die Hand gegeben werden, mit deren Hilfe sie ihren Energieverbrauch im Verhältnis zu vergleichbaren Dienststellen einschätzen können.
Um den Einsatz der vorhandenen Ressourcen zu optimieren, sollte eine Portfolio-Analyse eingeführt werden. Diese teilt den Gebäudebestand in vier Gruppen und macht leicht erkennbar, in welchen Gebäuden Investitionen am wirtschaftlichsten eingesetzt werden können und welche Gebäude vorrangig zu behandeln sind.
3.2 Energiemanagement und technische Verbesserungen
Der Rechnungshof empfiehlt, auch die Erdgaslieferung so bald wie möglich zentral auszuschreiben, um dadurch Kosten einzusparen. Mit der zentralen Ausschreibung der Erdgaslieferung sollte auch die Korrektur der Bestellleistungen einhergehen.
Zur Optimierung des Gebäudebetriebs sollte die Präsenz der Mitarbeiter des technischen Gebäudemanagements in den Liegenschaften erhöht werden. Große Liegenschaften sollten alle zwei Jahre während der Heizperiode von einem dieser Mitarbeiter begangen werden, um die Optimierung des Gebäudebetriebs und den Energieverbrauch zu prüfen. Durch das Hinzuziehen von Ansprechpartnern aus dem Bau- und Gebäudemanagement ist mit weiteren Synergien zu rechnen.
Insbesondere bei Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sollte auf die energetische Optimierung der technischen Anlagen und der Gebäude geachtet werden. Dabei können auch im Altbaubereich Brennwertkessel eingebaut werden. An den Heizverteilungen könnten die Anzahl der Heizkreise verringert und die technische Wärmedämmung verbessert werden.
Präsenzmelder in Büros oder Zeitsteuerungen in Fluren und Hallen können Energie sparen. Durch einfache technische Lösungen könnte der Verbrauch von DV-Anlagen im Stand-by-Betrieb um 75 % reduziert werden.
Es sollte sichergestellt werden, dass alle Nutzer ihre Energieverbräuche monatlich erfassen und einmal jährlich so an die Betriebsleitung übermitteln, dass sie automatisch ausgewertet werden können. Automatische Ausreißermeldungen und Benchmarks helfen, die größten Optimierungspotenziale zu erkennen.
Seit 2005 werden die Nutzer der landeseigenen Gebäude über ihre Bewirtschaftungskosten informiert. Diese Nutzerinformation ist allerdings nicht aussagekräftig und entwickelte bisher kaum eine Wirkung. Neben Informationen zu den Kosten benötigen die Nutzer auch Informationen zum Energieverbrauch sowie Anreize zur Energieeinsparung, welche durch Bonusmodelle gesetzt werden könnten.
3.3 Innovative Konzepte
Das technische Gebäudemanagement sollte als Impulsgeber für den Einsatz regenerativer Energien aufgebaut werden. Da sogar private Bauherren, die mit kürzeren Amortisationszeiten kalkulieren müssen als das Land, Bürohäuser in Passivbauweise oder Schulen in Niedrigenergiebauweise erstellen, sollte auch das Land versuchen, hier vorbildlich zu arbeiten.
Für Neuplanungen sollte eine nutzungstypologische Checkliste erarbeitet werden, die die Untersuchung des Einbaus einer bestimmten ressourcenschonenden Technologie vorgibt (z. B. Solarthermie, Regenwassernutzung).
3.4 Sondertitel
Zur Verbesserung der energetischen Ausstattung und Energieeinsparung schlägt der Rechnungshof vor, die Einrichtung eines haushalterischen Sondertitels (z. B. „Ressourcenschonendes Bauen“) zu erwägen. Ähnlich dem praktizierten Programm „Verwaltungsinterne Refinanzierung von Energiesparmaßnahmen“ (VIRE) könnten mithilfe dieses Titels Energiekonzepte umgesetzt werden, die sonst im üblichen Kostenrahmen der (Neubau-) Maßnahmen nicht finanzierbar wären. Solche zusätzlichen Ausgaben werden sich aus heutiger Sicht in wenigen Jahren amortisieren.
Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Einrichtung des Kapitels 1240 „Impulsprogramm Baden-Württemberg“, welches für 2008 und 2009 Landesmittel in Höhe von 10 Mio. € für die energetische Sanierung sowie den Einsatz regenerativer Energien in Landesgebäuden vorsieht. Der Freistaat Bayern hat für ein vergleichbares Programm 200 Mio. € bis zum Jahr 2020 bereitgestellt.
4 Stellungnahme des Ministeriums
Das Finanzministerium führt in seiner Stellungnahme aus, dass seit Einführung des technischen Gebäudemanagements 1997 auf der Grundlage strategischer Vorgaben und klarer Aufgabenfestlegungen messbare Erfolge erzielt worden seien. Die vom Rechnungshof kritisierte Ausgabensteigerung für die Energieversorgung liege unter der allgemeinen Energiepreissteigerung, die zwischen 33 % (Strom) und 55 % (Erdgas) betrage.
Die verfügbaren Mittel des Bauhaushalts seien nicht ausreichend, um die Gebäudehüllen der landeseigenen Gebäude flächendeckend zu sanieren. Außerdem bestehe kein gesetzlicher Zwang zur Nachrüstung des Gebäudebestands auf das Niveau der Energieeinsparverordnung von 2007.
Die Vorschläge des Rechnungshofs zur Optimierung des Gebäudebetriebs großer Liegenschaften entsprächen in den Grundzügen dem von der Vermögens- und Bauverwaltung eingeführten Verfahren zur verstärkten Betriebsüberwachung. Eine zentrale Ausschreibung der Gaslieferungen für alle Heizzentralen mit mehr als 1 Megawatt Leistung zum 01.10.2008 werde derzeit vorbereitet. Das Energiecontrolling in den Vermögens- und Bauämtern sei weiter entwickelt, als der Rechnungshof dies darstelle.
Das Finanzministerium räumt ein, dass die derzeitige Personalkapazität im technischen Gebäudemanagement kaum ausreiche, um die gestellten Aufgaben angemessen zu erledigen. Die Bündelung der Fachkunde in den Ämtern werde geprüft, außerdem würden für die Bewältigung komplexer Aufgaben auch externe Partner herangezogen. Nicht geteilt werde die Auffassung des Rechnungshofs, dass das technische Gebäudemanagement mit unnötigen Nebenaufgaben befasst sei.
Anregungen des Rechnungshofs zur Erweiterung der Nutzerinformation um die Energieverbrauchsangaben würden derzeit bereits umgesetzt. Zur Forderung des Rechnungshofs nach innovativen Konzepten für eine stärkere Nutzung erneuerbarer Energien verweist das Finanzministerium auf die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts 2010 für landeseigene Gebäude, das den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien vorsieht.
Neben dem Impulsprogramm für Klimaschutzmaßnahmen und dem VIRE-Programm seien derzeit keine Sondermittel für energiesparende Maßnahmen vorgesehen. Zusätzlich erforderliche Kosten müssten im Rahmen der im Bauhaushalt zur Verfügung stehenden Mittel veranschlagt werden.
5 Schlussbemerkung
Der Rechnungshof bleibt bei seiner Auffassung, dass allein schon aus wirtschaftlichen Gründen weitere Anstrengungen zum Einsparen von Energie in landeseigenen Gebäuden notwendig sind. Soweit dafür im Bauhaushalt keine ausreichenden Mittel zur Verfügung stehen, sollten Sondermittel bereitgestellt werden, die sich bei angemessenem Einsatz in kurzer Zeit amortisieren. Nur aus den nach den „Richtlinien für die Baukostenplanung“ veranschlagten (und „gedeckelten“) Baukosten für Neubau- und Sanierungsmaßnahmen sind in den meisten Fällen zusätzliche energiesparende Maßnahmen am Gebäude und in der Anlagentechnik nicht zu finanzieren.
Verstärkt werden muss aus Sicht der Finanzkontrolle der Ausbau des technischen Gebäudemanagements als Schwerpunktaufgabe der staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung. Falls dies nicht auf anderem Wege möglich ist, müssen Personalkapazitäten aus Tätigkeitsfeldern der Vermögens- und Bauverwaltung, die für die Wirtschaftlichkeit eine geringere Bedeutung haben, in diesen Bereich verlagert werden.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Einzelplan 14: Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Bei der Bestellung von Gastprofessoren sollten die Hochschulen die Verträge sorgfältiger formulieren. Die Verträge sollten sich an der Verwaltungsvorschrift des Wissenschaftsministeriums orientieren und die Aufgaben des Gastprofessors explizit und messbar definieren. Als Vergütung kommen auch Beträge unterhalb der vom Ministerium vorgesehenen Höchstsätze in Betracht. Anstelle von Gastprofessuren, die weniger als einen Monat dauern oder nur Dienstaufgaben in der Lehre umfassen, sollten Lehraufträge vereinbart werden.
1 Vorbemerkung
Nach dem Landeshochschulgesetz können die Hochschulen für einen im Voraus begrenzten Zeitraum für bestimmte Aufgaben in Forschung, Lehre, Kunst und Weiterbildung Hochschullehrer anderer Hochschulen oder Persönlichkeiten aus der wissenschaftlichen oder künstlerischen Praxis, die die Voraussetzungen für eine Professur erfüllen, als Gastprofessoren bestellen.
Gastprofessoren werden auf der Grundlage eines (zivilrechtlichen) Vertrags zwischen der Hochschule und dem als Gastprofessor vorgesehenen Wissenschaftler bestellt. Vorgaben über das dabei zu beachtende Verfahren und die Ausgestaltung der Gastprofessur enthält die Verwaltungsvorschrift des Wissenschaftsministeriums für die Bestellung von Gastprofessorinnen und Gastprofessoren an den Hochschulen des Landes (VwV Gastprofessoren).
Nach dieser Verwaltungsvorschrift können Gastprofessoren an Hochschulen eine Vergütung erhalten, die sich an der Besoldung eines beamteten Professors orientiert. Der für beamtete Professoren geltende Grundgehaltssatz (Besoldungsgruppe W 3, bei Fachhochschulen im Regelfall W 2) darf regelmäßig um 30 %, in besonders begründeten Ausnahmefällen sogar um 70 % überschritten werden.
Der Rechnungshof hat in einer Querschnittsprüfung alle Gastprofessuren im Studienjahr 2005/2006 an den 48 Hochschulen und vier Universitätsklinika des Landes untersucht.
2 Übersicht
Insgesamt wurden an den Hochschulen des Landes im Prüfungszeitraum 151 Gastprofessur-Verträge mit 144 Wissenschaftlern abgeschlossen.
Wie sich diese Gastprofessuren auf die einzelnen Hochschulen und Hochschuleinrichtungen verteilen, zeigt Tabelle 1.

Jeweils eine Gastprofessur bestand an den Hochschulen Biberach, Konstanz, Nürtingen-Geislingen, Ravensburg-Weingarten, Reutlingen, Stuttgart, an der Hochschule der Medien in Stuttgart, der Pädagogischen Hochschule Freiburg und den Universitätsklinika Freiburg, Heidelberg und Tübingen.
Die vereinbarte Beschäftigungsdauer der Gastprofessuren betrug durchschnittlich 3 ½ Monate, im kürzesten Fall zwei Tage, im längsten Fall drei Jahre.
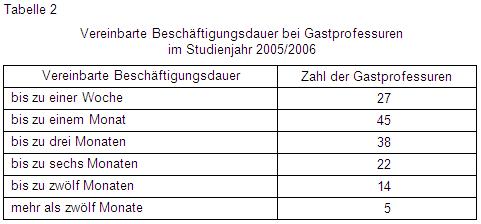
Die Gastprofessorinnen und Gastprofessoren kamen aus 32 verschiedenen Herkunftsländern. Die wichtigsten Herkunftsländer waren die Vereinigten Staaten (50), Frankreich (24), Russland (12), Deutschland (9), Kanada (6), China (5) und Großbritannien (5).
Finanziert wurden die Gastprofessuren
- in 65 Fällen ausschließlich aus Haushaltsmitteln des Landes,
- in 15 Fällen aus Haushaltsmitteln und ergänzenden Drittmitteln,
- in 47 Fällen aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes sowie
- in 23 Fällen aus privaten Drittmitteln.
Einer der Gastprofessoren erhielt keine Vergütung.
Insgesamt haben die Hochschulen und Hochschuleinrichtungen im Studienjahr 2005/2006 die Summe von 1,76 Mio. € für Gastprofessuren ausgegeben, davon stammten 0,68 Mio. € aus Haushaltsmitteln, 0,78 Mio. € aus öffentlichen Drittmitteln und 0,3 Mio. € aus privaten Drittmitteln.
Die Universitäten Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart und Tübingen sowie die Hochschule der Medien Stuttgart und die Universitätsklinika Freiburg, Heidelberg und Tübingen finanzierten mehr als 80 % ihrer Ausgaben aus Drittmitteln, während an der Universität Ulm, den Hochschulen Biberach, Konstanz, Nürtingen-Geislingen, Reutlingen, Stuttgart, der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und der Universitätsklinik Ulm ausschließlich Haushaltsmittel für die Gastprofessuren in Anspruch genommen wurden.
Die Ausgaben der Hochschulen für einen vollzeitbeschäftigten Gastprofessor betrugen im Durchschnitt 1.221 € je Woche. Die höchsten Vergütungen wurden an der Universitätsklinik Freiburg und an der Universität Freiburg (Ausgaben in Höhe von 1.918 € bzw. 1.644 € je Woche), die geringsten Vergütungen an der Universitätsklinik Ulm (748 €) gewährt.
3 Kritische Feststellungen
3.1 Anwendung der Verwaltungsvorschrift Gastprofessoren
In 19 von 151 Fällen blieb die VwV Gastprofessoren gänzlich unbeachtet oder es wurden nicht die dort vorgesehenen Musterverträge verwendet.
Dadurch entstanden für das Land finanzielle und rechtliche Nachteile und Risiken, die sich allerdings nur in Einzelfällen realisiert haben.
3.2 Höhe der Vergütung
Die in der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums genannten Vergütungssätze (W-Besoldung und Leistungsbezüge) sind Obergrenzen und müssen von den Hochschulen nicht ausgeschöpft werden. Gleichwohl haben sich die meisten Hochschulen an diesen Höchstsätzen orientiert.
Die Universität Karlsruhe hat die Höhe der Vergütung für Gastprofessoren durch eine universitätsinterne Regelung unterhalb dieser Höchstsätze begrenzt und dadurch in erheblichem Umfang Mittel eingespart. Diese Regelung sollte Vorbild für andere Hochschulen sein.
Die Universität Freiburg hat in mehreren Fällen die in der VwV vorgesehenen, ohnehin großzügig bemessenen Höchstsätze überschritten: In 14 Fällen gewährte sie Gastprofessoren Vergütungen, die das Grundgehalt eines beamteten Professors um mehr als 70 % überstiegen.
3.3 Kurzfristige Gastprofessuren
Kurzfristige Gastprofessuren von wenigen Tagen führen häufig zu einem Missverhältnis zwischen den Leistungen und der Vergütung des Gastprofessors. Sie entsprechen nicht dem Leitbild, das § 55 Landeshochschulgesetz einer Gastprofessur zugrunde legt.
In einigen Fällen wurde festgestellt, dass arbeitsfreie Tage und Wochenenden in die Gastprofessuren einbezogen wurden, obwohl diese nur wenige Tage dauerten, um auf diese Weise eine höhere Vergütung zu ermöglichen.
3.4 Langfristige Gastprofessuren
Gastprofessuren sollten nur im Ausnahmefall mehr als 12 Monate umfassen, da anderenfalls die Gefahr besteht, dass ein reguläres Berufungsverfahren umgangen wird. Sollten sie dennoch vereinbart werden, bedürfen sie der (vorherigen) Zustimmung des Wissenschaftsministeriums.
In vier von fünf Fällen wurde diese Zustimmung von der Hochschule nicht oder nicht rechtzeitig eingeholt.
3.5 Unzureichende vertragliche Vereinbarungen
Die Verträge mit den Gastprofessoren müssen neben den vertraglichen Verpflichtungen des Landes auch die Pflichten der Professoren definieren, insbesondere den vorgesehenen Beschäftigungsumfang und die wahrzunehmenden Dienstaufgaben. Die Lehrverpflichtung hat sich dabei an der Lehrverpflichtungsverordnung der Landesregierung zu orientieren.
In mehr als einem Drittel der geprüften Verträge fehlte eine Vereinbarung über den Beschäftigungsumfang. In 23 Verträgen waren weder der Beschäftigungsumfang noch die vom Gastprofessor wahrzunehmenden Dienstaufgaben definiert. In weiteren 16 ausschließlich aus Haushaltsmitteln finanzierten Fällen lag die vereinbarte Lehrverpflichtung unter den Vorgaben der Lehrverpflichtungsverordnung.
3.6 Gastprofessur ausschließlich für Lehraufgaben
Das Leitbild der Gastprofessur umfasst die Wahrnehmung aller Aufgaben, die typischerweise von einem Professor der betreffenden Hochschule wahrzunehmen sind. Die Vereinbarung einer Gastprofessur sollte daher nicht in Betracht kommen, wenn auch die Erteilung eines Lehrauftrags ausreichend ist.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Gastprofessor ausschließlich Aufgaben in der Lehre wahrnehmen soll.
Bei 60 Gastprofessuren des Studienjahres 2005/2006 (davon 28 ganz oder überwiegend aus Haushaltsmitteln finanziert) wurden über die Lehrverpflichtung hinaus keine weiteren Dienstaufgaben vereinbart. In diesen Fällen hätte daher regelmäßig ein Lehrauftrag ausgereicht, um die Dienstleistung des Gastprofessors in der Lehre zu sichern.
3.7 Rechtlich unwirksame Befristung
Das Teilzeit- und Befristungsgesetz enthält Regelungen, an die die Wirksamkeit der Befristung eines Arbeitsvertrages geknüpft ist.
Bei 76 der 151 geprüften Verträge wurde festgestellt, dass diese gesetzlichen Vorgaben nicht eingehalten waren. Das bedeutet, dass die Gastprofessoren möglicherweise einen Rechtsanspruch auf Weiterbeschäftigung über die (unwirksam) vereinbarte Frist hinaus gehabt hätten. Mehr als die Hälfte der beanstandeten Fälle betraf die Universitäten Karlsruhe und Freiburg.
3.8 Mängel im Vollzug der Verträge
In sieben Fällen ergab sich aus den Akten, dass die tatsächliche Beschäftigungsdauer hinter der vertraglich vereinbarten zurückblieb. Gleichwohl wurden die vollen Bezüge ausgezahlt. Dies fällt insbesondere bei kurzfristigen Gastprofessuren deutlich ins Gewicht.
Zur Vermeidung von Doppelbeschäftigungsverhältnissen muss der Gastprofessor gegenüber der gastgebenden Hochschule erklären, dass er in seinem Hauptamt (zumeist an einer anderen Hochschule) für die Dauer der Gastprofessur beurlaubt oder freigestellt ist. Wenn eine solche Beurlaubung oder Freistellung nicht erfolgt ist, müssen die Bezüge aus dem Hauptamt auf die Vergütung der Gastprofessur angerechnet werden.
In 30 Fällen ist eine solche Beurlaubung weder nachgewiesen noch zugesichert worden. Eine Anrechnung hauptamtlicher Bezüge ist in keinem der geprüften Fälle erfolgt.
In 29 Fällen wurden Vergütungen ausbezahlt, obwohl sie nach den Verträgen noch nicht fällig waren.
Zahlreiche Fehler wurden bei der Vereinbarung und Abrechnung der Reisekosten der Gastprofessoren festgestellt.
4 Empfehlungen
4.1 Die Verwaltungsvorschrift Gastprofessoren und ihr Vollzug durch die Hochschulen
Die VwV Gastprofessoren hat sich als sinnvolle und notwendige Grundlage für die Bestellung von Gastprofessoren im Wesentlichen bewährt.
Behoben werden müssen die aufgezeigten Vollzugsdefizite bei den Hochschulen: Die Hochschulen sollten ihren Verträgen mit Gastprofessoren immer die Verwaltungsvorschrift zugrunde legen. Die dort vorgesehenen Vergütungen sollten allerdings als Höchstsätze betrachtet und nur ausnahmsweise angewendet werden. Den Hochschulen wird empfohlen, nach dem Vorbild der Universität Karlsruhe hochschulintern eigene Höchstsätze festzulegen.
4.2 Aufgabenspektrum und Beschäftigungsumfang
Das Aufgabenspektrum und der Beschäftigungsumfang, die von den Gastprofessoren erwartet werden, sind im Vertrag explizit und messbar zu vereinbaren. Sie müssen sich am Leitbild einer regulären Professur orientieren und dürfen sich nicht auf Ausschnitte aus der Professorentätigkeit beschränken.
4.3 Lehraufträge statt Gastprofessuren
Gastprofessuren sollten künftig nur noch dann vereinbart werden, wenn die Aufgaben, die der Gastprofessor wahrnimmt, im Wesentlichen den Aufgaben eines regulären Professors an der betreffenden Hochschule entsprechen.
Dies ist regelmäßig nicht der Fall, wenn
- die Gastprofessur auf weniger als einen Monat befristet ist oder
- das mit dem Gastprofessor vereinbarte Aufgabenspektrum ausschließlich Dienstleistungen in der Lehre umfasst.
In diesen Fällen reicht die Erteilung eines Lehrauftrags aus. Die Vergütung ist dann nicht an der Besoldung eines beamteten Professors zu orientieren, sondern entsprechend der Vergütungssätze für Lehrbeauftragte festzusetzen.
Um gleichwohl auch prominente Gastwissenschaftler für solche Lehraufträge gewinnen zu können, sollte das Landeshochschulgesetz vorsehen, den Lehrbeauftragten, die die Voraussetzungen für eine Professur erfüllen, für die Dauer des Lehrauftrags den Titel „Gastprofessor“ zu verleihen.
5 Stellungnahme des Ministeriums
Das Wissenschaftsministerium ist bereit, die Anregungen des Rechnungshofs aufzunehmen und, wo möglich, umzusetzen.
Es kündigt an, die Hochschulen erneut auf die Beachtung der VwV Gastprofessoren hinzuweisen, insbesondere auf die Anwendung der dort vorgesehenen Musterverträge.
Weiterhin weist das Ministerium darauf hin, dass die Hochschulen berechtigt sind, im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel den in der Verwaltungsvorschrift vorgesehenen Vergütungsrahmen auszuschöpfen; beim internationalen Wissensaustausch seien auch Fälle denkbar, in denen eine Gastprofessur ausnahmsweise nicht das gesamte Spektrum einer regulären Professur abdecken könne.
Das Ministerium wird die Hochschulen in Übereinstimmung mit den Vorschlägen des Rechnungshofs auf das geltende Subsidiaritätsprinzip hinweisen, also den Vorrang von Lehraufträgen gegenüber einer Gastprofessur. Der vom Rechnungshof vorgeschlagenen Änderung des Landeshochschulgesetzes, wonach Lehrbeauftragten der Titel „Gastprofessor“ verliehen werden kann, tritt das Ministerium mit dem Argument entgegen, dass bei der Gewinnung von Gastprofessoren neben der Übertragung des Titels gleichgewichtig monetäre Aspekte von Bedeutung seien, denen durch die vom Rechnungshof vorgeschlagene Vorgehensweise nicht ausreichend Rechnung getragen werden könne.
6 Schlussbemerkung
Der Rechnungshof hält an seiner Auffassung fest, dass an die Stelle kurzfristiger Gastprofessuren künftig in der Regel Lehraufträge treten sollten, die durch die Möglichkeit, den Titel „Gastprofessor“ zu verleihen, attraktiver gestaltet werden können.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Bei der Bewirtschaftung der Personalunterkünfte ergaben sich im Jahr 2006 an drei Universitätsklinika Unterdeckungen von insgesamt 1,1 Mio. €. Am vierten Klinikum lagen die Erlöse um 0,4 Mio. € über den Kosten. Ein Teil der Unterdeckungen ist auf die rechtlich nicht gebotene Anwendung des Tarifvertrags über die Bewertung der Personalunterkünfte zurückzuführen. Der Rechnungshof hat Möglichkeiten zur Verbesserung der wirtschaftlichen Ergebnisse aufgezeigt.
1 Vorbemerkung
Die Universitätsklinika (UK) halten in unterschiedlichem Umfang Personalunterkünfte vor, die sie insbesondere ihren Beschäftigten sowie den zur Dienstleistung zugewiesenen Ärzten, Schülern, Auszubildenden und Zivildienstleistenden zur Verfügung stellen. Vereinzelt werden die Unterkünfte auch von Externen, beispielsweise Gastwissenschaftlern, genutzt.
Bei der Ausgestaltung der Mietverhältnisse gehen die Klinika unterschiedliche Wege. Drei schließen mit den Beschäftigten regelmäßig Verträge für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses ab, dadurch steht eine entsprechend langfristige Unterbringung im Vordergrund. Ein Klinikum befristet dagegen die Mietdauer auf ein Jahr. Mietverträge mit Ärzten sind bei drei Klinika auf drei Monate befristet, ein Klinikum vermietet auch längerfristig. Zielsetzung der kurzzeitigen Überlassung von Wohnraum ist es, neuen Beschäftigten eine „Starthilfe“ am neuen Arbeitsplatz zu geben.
2 Rechtsgrundlagen
Für die Klinika besteht keine rechtliche oder tarifliche Pflicht, Personalunterkünfte vorzuhalten; es handelt sich um eine freiwillige Leistung.
Für die Bewirtschaftung der Personalunterkünfte ziehen die Klinika den Tarifvertrag über die Bewertung der Personalunterkünfte (Tarifvertrag) heran, der insbesondere die Miethöhe regelt. Hierzu wird der Wohnraum nach verschiedenen Ausstattungsmerkmalen, sogenannte Wertklassen, eingeteilt (z. B. eigenes Bad oder gemeinschaftliche Nutzung) und entsprechend eine unterschiedlich hohe Miete je Quadratmeter festgesetzt. Die im Prüfungszeitraum angewendeten Mietpreise je Quadratmeter (Warmmiete) sind in der Tabelle 1 aufgeführt.
Eine Anpassung der Miethöhen an örtliche Besonderheiten oder eine Abrechnung von Nebenkosten ist nach dem Tarifvertrag nicht möglich. Da eine jährliche Preisanpassung analog der Steigerung in der Sachbezugsverordnung vorgeschrieben ist, durften die Klinika die Mieten nicht individuell an Kostensteigerungen anpassen.
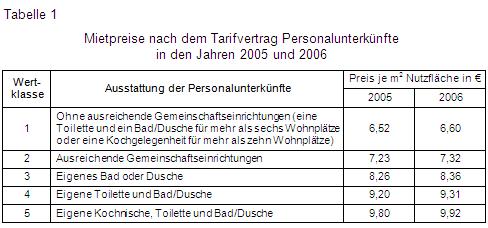
Die Klinika gingen davon aus, zur Anwendung des Tarifvertrags verpflichtet zu sein. Aus Sicht des Rechnungshofs ist dies nicht zwingend.
Zur Abgrenzung des Anwendungsbereichs des Tarifvertrags ist die Unterscheidung zwischen Dienstwohnungen und Werkmietwohnungen wesentlich. Kennzeichen der Dienstwohnung ist die Pflicht des Arbeitnehmers, dort zu wohnen, weil der Bezug der Wohnung für die Ausübung des Dienstes erforderlich ist (z. B. Hausmeisterwohnung). Aus einem Beschluss des Bundesarbeitsgerichts von 1992 kann abgeleitet werden, dass der Tarifvertrag für möblierte Dienstwohnungen gilt. Bei einer Werkmietwohnung dagegen ist der Bezug freiwillig, die Überlassung der Wohnung ist keine Voraussetzung für die Erbringung der Arbeitsleistung. So liegt der Fall bei den hier untersuchten Personalunterkünften. Sie erfüllen daher die Merkmale von Werkmietwohnungen. Somit fallen die von den Klinika bewirtschafteten Unterkünfte nicht unter den Anwendungsbereich des Tarifvertrags.
Nachdem dem Rechnungshof bekannt geworden war, dass die Klinika im Jahr 2007 Verhandlungen auch über die Weitergeltung des Tarifvertrags führten, wies er sie über das Wissenschaftsministerium auf die dargestellte Rechtsauffassung hin. Die daraufhin von den Klinika auf dieser Grundlage begonnenen Tarifverhandlungen dauern noch an.
3 Strukturdaten und Auslastung
3.1 Anzahl der Unterkünfte und Wohnflächen
Die vier Klinika bewirtschafteten im Jahr 2006 insgesamt 2.452 Unterkünfte auf rd. 90.000 m² Gesamtfläche. Diese verteilen sich auf die Kategorien: Nutzfläche, Gemeinschaftsfläche und Verkehrsfläche. Nach dem Tarifvertrag wird nur die Nutzfläche für die Mietberechnung berücksichtigt. Mit rd. 50.000 m² entfiel etwas mehr als die Hälfte der Gesamtfläche auf die Nutzfläche als Wohnfläche im engeren Sinn. Die durchschnittliche Nutzfläche einer Unterkunft beträgt 20 m².
3.2 Ausstattungsstandard der Unterkünfte (Wertklassen)
Die Unterkünfte der Klinika weisen unterschiedliche Ausstattungsstandards auf, die sich auf den Mietpreis je m² auswirken.
Bei den Klinika verfügten insgesamt 54 % der Unterkünfte über keine eigene sanitäre Einrichtung oder keine eigene Küche. Der Anteil dieser einfachen Unterkünfte am Wohnungsbestand reichte von 4 % bis 77 %. Insgesamt waren nur 26 % der Unterkünfte so ausgestattet, dass die Bewohner keine Gemeinschaftsräume in Anspruch nehmen mussten.
3.3 Nutzung der Personalunterkünfte
3.3.1 Auslastungsquote
Die Auslastungsquoten lagen im Jahr 2006 zwischen 76 % und 91 %, bei einem Durchschnitt von 85 %. Sie werden durch verschiedene Aspekte beeinflusst: Ein Leerstand kann beispielsweise durch notwendige Renovierungsarbeiten bedingt sein, auf mangelnde Nachfrage hinweisen oder durch den verzögerten Abschluss eines neuen Mietvertrags verursacht sein. Die Klinika ließen einen Teil der Unterkünfte bewusst leer stehen. Manche davon sollten als Unterbringungsreserve für kurzfristige Einzüge zur Verfügung stehen, andere wurden zum jeweiligen Ausbildungsbeginn für Schüler und Auszubildende reserviert. Bei zwei Klinika ist den Nutzern ein Auszug ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist täglich möglich, wodurch eine nahtlose Anschlussvermietung schwierig wird. Bei den anderen Klinika sind dagegen Kündigungsfristen einzuhalten, was eine direkte Anschlussvermietung erleichtert.
3.3.2 Nutzer der Personalunterkünfte
34 % der Wohnungen wurden von Schülern und Auszubildenden bewohnt; vom Pflegedienst und vom Medizinisch Technischen Dienst 27 %. Die Werte der einzelnen Klinika unterscheiden sich deutlich.
Die Klinika hatten durchschnittlich 6 % ihrer Beschäftigten (einschließlich Schüler und Auszubildende) in Personalunterkünften untergebracht. Während lediglich 2 % der Ärzte, 4 % des Medizinisch Technischen Dienstes und 3 % der sonstigen Beschäftigten in den Personalunterkünften wohnten, waren dort 55 % der Schüler und Auszubildenden untergebracht. Diese profitierten damit am meisten von den angebotenen Personalunterkünften.
4 Kosten, Erlöse und Kostendeckungsgrad
Für den Betrieb der Personalunterkünfte fielen im Jahr 2005 insgesamt Kosten von 5,5 Mio. €, im Jahr 2006 von 5,4 Mio. € an. Bezogen auf die einzelnen Standorte reichten die jährlichen Kosten von 1,0 bis 1,8 Mio. €.
Aus der Bewirtschaftung der Personalunterkünfte nahmen die Klinika im Jahr 2005 insgesamt Erlöse in Höhe von 4,5 Mio. €, im Jahr 2006 von 4,7 Mio. € ein. Bezogen auf die einzelnen Standorte reichten die Gesamterlöse von 0,7 bis 1,9 Mio. €.
Drei Klinika erwirtschafteten im Jahr 2005 Unterdeckungen in Höhe von insgesamt 1,3 Mio. €, im Jahr 2006 von 1,1 Mio. €. Bei einem Klinikum lagen die Erlöse im Jahr 2005 um 0,3 Mio. €, im Jahr 2006 um 0,4 Mio. € über den Kosten. Die unzureichende Höhe der Erlöse beruht im Wesentlichen darauf, dass die Klinika für die Unterkünfte der Beschäftigten den Tarifvertrag angewandt haben.
Bei den Mieten für externe Nutzer (Gäste) gab es zum Teil erhebliche Unterschiede; allerdings erhob nur ein Klinikum Mieten, die nicht kostendeckend waren.
Die jährlichen Kosten und Erlöse je Nutzer sind in Tabelle 2 dargestellt.
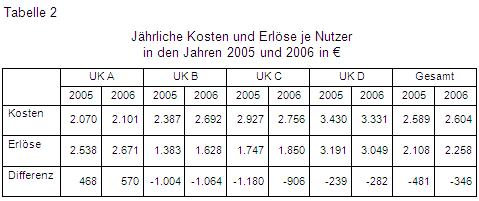
Im Jahr 2006 lagen die Gesamtkosten je Nutzer zwischen rd. 2.100 € beim UK A und rd. 3.300 € beim UK D. Die Erlöse je Nutzer wiesen eine Bandbreite von rd. 1.400 € beim UK B und rd. 3.000 € beim UK D auf. Stellt man Kosten und Erlöse je Nutzer gegenüber, zeigt sich, in welcher Höhe die Unterbringung eines Nutzers aus sonstigen Finanzmitteln subventioniert wird. Während das UK A nicht auf eine solche Subventionierung angewiesen war, betrug sie beim UK B im Jahr 2006 rd. 1.100 €. Der Durchschnitt lag bei rd. 300 €.
5 Strukturelle Neuorientierung und Ansätze zur Erhöhung der Kostendeckung
5.1 Ziele des Vorhaltens von Wohnmöglichkeiten
Der Rechnungshof empfiehlt zu klären, welche Ziele mit dem Betrieb von Personalwohnheimen verfolgt werden und zu überprüfen, ob die praktizierte Bewirtschaftung diesen Zielen dient. Bei der Vertragsdauer ist die Wirkung abzuwägen, die von einer dauerhaften Unterbringung über unbefristete Verträge ausgeht. Die Klinika sollten insbesondere klären, ob befristete Verträge als „Starthilfe“ günstiger sind, um neue Mitarbeiter zu gewinnen.
Die Klinika machen gelten, das Vorhalten von Personalunterkünften sei angesichts des sich abzeichnenden Fachkräftemangels von großer Bedeutung. Deshalb wollen sie weiterhin Unterkünfte anbieten. Besondere Wettbewerbsvorteile ergeben sich aus der Möglichkeit einer kurzfristigen Unterbringung.
Die Klinika kündigten an, die Ausgestaltung der Mietverhältnisse zu überprüfen. So soll beispielsweise eine dauerhafte Unterbringung künftig entfallen; je nach Standort seien Mietverhältnisse zwischen maximal einem Jahr und drei Jahren vorgesehen. An manchen Standorten solle die Unterbringungskapazität reduziert werden. Vor allem Wohnungen mit niedrigem Ausstattungsstandard sollen aufgegeben werden.
5.2 Maßnahmen zur Erhöhung des Kostendeckungsgrades
Für den Fall, dass die Klinika auch weiterhin Wohnraum zur Verfügung stellen, zeigt der Rechnungshof verschiedene Möglichkeiten für eine Erhöhung der Kostendeckung auf.
Zum einen ergibt sich eine höhere Kostendeckung über eine Reduzierung der Kosten. Ein Ansatzpunkt ist, freiwillige „Serviceleistungen“ der Klinika im Standard zu reduzieren oder auf die Bewohner zu übertragen. Beispiele für solche Serviceleistungen sind die Reinigung der Unterkünfte und das Angebot von Bettwäsche und Handtüchern. Allein die Reinigung der Personalwohnheime führte im Jahr 2006 zu Kosten von 0,7 Mio. €. Der Rechnungshof regt eine Überprüfung an, ob die Serviceleistungen der Klinika im momentan vorgehaltenen Umfang erforderlich sind, und empfiehlt, für die erbrachten Leistungen eine Kostenbeteiligung der Nutzer zu erheben.
Zum andern kann eine höhere Kostendeckung durch höhere Mieterlöse erreicht werden. Diese Erlöse werden durch die Auslastung und die Preise je Quadratmeter beeinflusst. Die im Jahr 2006 erzielte durchschnittliche Auslastungsquote von 85 % bedeutet, dass jede Wohnung 1,8 Monate leer stand. Der Rechnungshof regt an, die Verwaltungsabläufe so zu optimieren, dass die Abstände zwischen Mietende und Mietbeginn je Wohnung verkürzt werden. Eine Erhöhung der Mietpreise je Quadratmeter ist abhängig von dem Ergebnis der Tarifverhandlungen.
Einzelne Klinika konnten durch Reduzierung der Reinigungsintervalle ihre Kosten verringern, teilweise wurden bereits die Personalkosten reduziert. Weitere Kostenreduzierungen, beispielsweise durch die Beteiligung der Bewohner an den Reinigungskosten, sind vom Ergebnis der zurzeit andauernden Tarifverhandlungen abhängig. Zur Verbesserung der Auslastung prüfen die Klinika außerdem die Einführung von Kündigungsfristen.
6 Zuschuss des Landes
Die Klinika erhalten vom Land über den Staatshaushaltsplan einen Zuschuss für „nicht entgeltfähige, betriebsnotwendige Kosten“. Dieser Zuschuss ist zweckgebunden für Instandhaltungsaufwendungen sowie andere nicht entgeltfähige Aufwendungen wie Mieten, Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern, Unterdeckungen aus dem Betrieb von Wohnheimen, Kindertagesstätten oder sonstigen sozialen Einrichtungen. Die Zuschussmittel können außerdem für die Finanzierung von Investitionen verwendet werden. Eine konkrete Gewichtung des Zuschusses nach den einzelnen genannten Zwecken erfolgt nicht, sodass die Klinika in der Verwendung des Zuschusses innerhalb der Zweckbestimmung frei sind. Im Einzelfall kann dies dazu führen, dass z. B. infolge eines positiven Ergebnisses der Wohnraumbewirtschaftung kein Zuschussbedarf für den Betrieb von Wohnheimen besteht. Dies führt wegen der fehlenden Gewichtung der Zuschusszwecke jedoch nicht zu einer Reduzierung des Zuschusses.
Weil sich aus der Prüfung Ansatzpunkte für die Klinika ergaben, Unterdeckungen aus dem Betrieb von Personalunterkünften zu reduzieren, bat der Rechnungshof das Wissenschaftsministerium, die Höhe des Zuschusses zu überprüfen.
Das Wissenschaftsministerium kündigte an, bei der Aufstellung des Staatshaushaltsplans 2009 auf der Grundlage des von den Klinika angemeldeten Bedarfs die Bemessung der Zuschusshöhe zu prüfen. Wegen der in den letzten Jahren nicht ausreichenden Investitionsmittel und neuer Schwerpunkte, wie z. B. dem Betrieb von Kindertagesstätten, sei es allerdings nicht zwangsläufig, dass rückläufige Kostenentwicklungen bei den Personalunterkünften zu einer Reduzierung dieses Zuschusstitels führen müssen.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Bei einem unter der Aufsicht des Landes stehenden Unternehmen auf dem Gebiet der Krankenversorgung fehlte es an einer effektiven Steuerung. Die interne und externe Kontrolle der Geschäftsführung waren unzureichend. Bei zahlreichen finanzwirksamen Maßnahmen wurden gravierende Mängel festgestellt. Ausgaben und Einnahmeausfälle in Höhe von mindestens 1,2 Mio. € hätten vermieden werden können.
1 Vorbemerkung
Der Rechnungshof prüfte im Jahr 2007 die Haushalts- und Wirtschaftsführung eines in Form einer öffentlich-rechtlichen Stiftung geführten und in der Krankenversorgung tätigen Unternehmens (im Folgenden Stiftung).
Die Prüfung umfasste die Jahre 2003 bis 2006. In diesem Zeitraum gewährte das Land Forschungs-, Investitions- und Betriebskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt rd. 31 Mio. €.
Die Erhebungen des Rechnungshofs gestalteten sich sehr aufwendig. Für den gesamten Verwaltungsbereich der Stiftung fehlten schriftliche Zuständigkeitsregelungen. Dieser Mangel war eng verknüpft mit der Praxis des Geschäftsführers, nahezu alle wesentlichen Vorgänge allein zu bearbeiten und bei sich zu archivieren. In keinem der geprüften Fälle wurden dem Rechnungshof - trotz Hinweis auf eine Offenlegungspflicht - die vollständigen Verfahrensakten zur Verfügung gestellt. Zum Teil wurden Fragen nicht bzw. nicht wahrheitsgemäß beantwortet.
Ein weiterer gravierender Mangel war, dass die Geschäftsführung bei den geprüften finanzwirksamen Vorgängen über keine Unterlagen verfügte, aus denen die kontinuierliche wirtschaftliche Entwicklung ersichtlich gewesen wäre. So wurden z. B. Betriebsergebnisse für die Bereiche Wäscherei, Essensversorgung und Fuhrpark sowie Wirtschaftlichkeitsanalysen für Investorenmodelle erstmals im Laufe der Prüfung ermittelt.
Auch als Konsequenz der laufenden Prüfung wurde zum 01.01.2008 die Geschäftsführung auf das örtliche Universitätsklinikum übertragen.
2 Sicherungs- und Kontrollmechanismen
2.1 Aufsichtsrat
Für eine effektive Unternehmenssteuerung ist eine wirksame Kontrolle der Geschäftsführung unabdingbar. Zu diesem Zweck ist bei der Stiftung ein Aufsichtsrat eingerichtet. Dessen Aufgaben sind in einer Satzung geregelt, in der wesentliche Elemente für eine Kontrolle der Geschäftsführung fehlen. Vor allem ist nicht klar geregelt, wann der Aufsichtsrat in Entscheidungen der Geschäftsführung einzubinden ist; seine vollständige Information über wichtige Geschäftsverläufe ist nicht gewährleistet. Andererseits war aus den Aufsichtsratsprotokollen nicht zu entnehmen, ob der Aufsichtsrat bei ersichtlich unvollständiger Information durch den Geschäftsführer über Vorgänge mit finanzwirtschaftlichem Hintergrund zusätzliche Informationen angefordert hat.
Der Rechnungshof schlug zur Optimierung der Aufsichtsratstätigkeit eine Geschäftsordnung vor, in die neben einer allgemeinen Zustimmung zum Wirtschaftsplan auch Wertgrenzen für zustimmungspflichtige Geschäfte aufgenommen werden sollten. Des Weiteren sollte die Satzung bzw. die Geschäftsordnung die Feststellung des Jahresergebnisses und die Entlastung der Geschäftsführung regeln sowie berücksichtigen, dass der Aufsichtsrat den Jahresabschluss zu prüfen hat.
Das Wissenschaftsministerium hat Maßnahmen zur Einführung einer Geschäftsordnung eingeleitet. Von einer grundlegenden Überarbeitung der Satzung will das Ministerium wegen der bis spätestens 31.12.2008 angestrebten Eingliederung der Stiftung in das Universitätsklinikum absehen. Der Aufsichtsrat hat inzwischen die Einrichtung eines Wirtschafts- und Personalausschusses beschlossen, der auch die Aufgaben eines Bilanzprüfungsausschusses wahrnehmen wird.
2.2 Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung
Die von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz durchgeführte Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung entsprach nicht den einschlägigen Prüfungsstandards. Verschiedene Feststellungen erfolgten entweder ohne eigene Prüfungshandlungen oder sie waren nicht ausreichend fundiert; teilweise wurden Feststellungen unzutreffend gewürdigt.
Das Land ist nach der Landeshaushaltsordnung verpflichtet, die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz zu veranlassen. Bei der künftigen Auftragsvergabe ist auf die Einhaltung der Prüfungsvorgaben durch die Prüfungsgesellschaft zu achten. Nach Mitteilung des Wissenschaftsministeriums hat ein Wechsel der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft stattgefunden, eine Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz wurde festgelegt.
2.3 Interne Revision
Die Stiftung war nicht mit einer eigenen Revision ausgestattet und somit nicht in der Lage, Abläufe und Strukturen eigenständig zu prüfen und im Bedarfsfall zu optimieren. Weder die Jahresabschlussprüfungen noch die unregelmäßigen Prüfungen des Rechnungshofs können die Funktion einer Internen Revision ersetzen.
Der Forderung des Rechnungshofs auf die Einrichtung einer Internen Revision wurde entsprochen. Ab 01.01.2008 wurde die Zuständigkeit der Internen Revision des Universitätsklinikums auf das Unternehmen ausgedehnt.
3 Vertragsmanagement
3.1 Allgemeines
Für die professionelle Führung eines Unternehmens ist ein qualifiziertes Vertragsmanagement unerlässlich. Wichtige Verträge betreffen insbesondere die Bereiche Lieferungen, Dienstleistungen und Wartungen. Vor allem sollte gewährleistet sein, dass die vergaberechtlichen Vorschriften beachtet, die Vertragsinhalte transparent und eindeutig festgelegt sowie die Vertragsunterlagen lückenlos archiviert werden.
Die vom Rechnungshof geprüften Vorgänge entsprachen diesen Mindestanforderungen nicht. In allen geprüften Fällen wurden eine nahezu vollständige Missachtung der Vergabevorschriften und eine mangelhafte Aktenführung festgestellt. Zudem hatte die Geschäftsführung keinen Überblick über die finanziellen Auswirkungen der jeweiligen Verpflichtungen. Dies führte u. a. dazu, dass die mit der Vergabe von Leistungen erhofften Einsparungen nicht immer erreicht, bestehende Einsparpotenziale nicht erkannt und steuerliche Fragen nicht geklärt wurden.
Aufgrund der festgestellten Mängel hält der Rechnungshof bei sämtlichen Vertragsabschlüssen mit Dienstleistern eine Wirtschaftlichkeitsprüfung für erforderlich. Dabei sollte auch geklärt werden, ob die Vergabe von Leistungen an Dritte tatsächlich die wirtschaftlichste Lösung darstellt.
3.2 Einzelfälle des Vertragsmanagements
3.2.1 Verspäteter Vertragsabschluss für physiotherapeutische Leistungen
Die Stiftung erbringt umfangreiche Leistungen auf dem Gebiet der Physiotherapie. Zur Abrechnung dieser Leistungen mit den Kostenträgern war es ab 01.07.2002 erforderlich, einem sogenannten Rahmenvertrag beizutreten. Die Stiftung unterzeichnete die Beitrittserklärung erst am 22.11.2006. Von verschiedenen Kostenträgern wurden wegen des vertragslosen Zustands die zwischen dem 01.01.2004 und 21.11.2006 erbrachten physiotherapeutischen Leistungen nicht vergütet. Der durch den verspäteten Beitritt zum Rahmenvertrag entstandene Schaden beläuft sich auf rd. 138.000 €.
Für den Schaden wurde die Haftpflichtversicherung für Eigenschäden nicht in Anspruch genommen. Der Geschäftsführer hatte die Auffassung vertreten, es sei schwierig, den genauen Verursacher festzustellen. Der Rechnungshof hält diese Einschätzung für nicht zutreffend. Unabhängig von einem fehlenden Geschäftsverteilungsplan sind die Abrechnung von Krankenhausleistungen und die entsprechenden vertraglichen Regelungen hierzu als Kernaufgaben einer speziell hierfür eingerichteten Abteilung anzusehen.
Auf Forderung des Rechnungshofs hat die Stiftung inzwischen die Ansprüche gegenüber der Versicherung geltend gemacht. Im Falle von nicht befriedigten Ansprüchen ist die Regressfrage zu klären.
3.2.2 Abrechnung von Behandlungs- und Schreibleistungen durch Dritte
Die Stiftung vergab die Abrechnung ihrer Leistungen für die Behandlung von Privatpatienten ohne Beachtung der vergaberechtlichen Vorschriften an einen externen Anbieter. Dieses Abrechnungsunternehmen wird von der Ehefrau eines Beschäftigten der Stiftung geleitet, der für die Abrechnung sämtlicher Behandlungsleistungen verantwortlich war. Einzelne Abrechnungssegmente aus dem beauftragten Bereich wurden zusätzlich - ohne Vergütungskürzung bei dem Abrechnungsunternehmen - an weitere drei Familienmitglieder des Beschäftigten vergeben. Zwei davon waren zum Vergabezeitpunkt und im Zeitraum der erbrachten Leistungen minderjährig.
Das Abrechnungsunternehmen wurde - ebenfalls ohne Ausschreibung - auch mit Schreibleistungen und mit dem Anfertigen von Kopien beauftragt. Die Preise für Kopien lagen um das 9-Fache bis 30-Fache über den Durchschnittssachkosten, die der Rechnungshof im Jahr 2000 ermittelt hatte. Selbst unter Berücksichtigung anfallender Personalkosten für das Kopieren dürften die Kosten für „Eigenkopien“ deutlich unter den mit dem Abrechnungsunternehmen vereinbarten Preisen liegen.
In allen hier aufgezeigten Fällen besteht die Gefahr von Interessenkonflikten. Der Rechnungshof forderte deshalb, die Leistungserbringung durch Familienangehörige einzustellen, die Verträge zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu beenden und die Übernahme der Leistungen durch die Stiftung selbst oder durch sein Beteiligungsunternehmen zu prüfen.
Die Stiftung hat das Vertragsverhältnis mit dem Abrechnungsunternehmen zum 30.09.2007 beendet und die Abrechnung anderweitig vergeben. Eingestellt sind auch Abrechnungsleistungen durch die minderjährigen Familienmitglieder des Mitarbeiters.
3.2.3 Essensversorgung
Die Essensversorgung in der Stiftung war unterschiedlich geregelt. Für den überwiegenden Teil des Personals ist ein sogenanntes Mitarbeitercasino und für die Ärzte war ein sogenanntes Ärztecasino eingerichtet. Die Patienten werden von einem externen Anbieter versorgt.
Die Umbaukosten des Ärztecasinos beliefen sich auf rd. 340.000 €. Davon entfielen rd. 145.000 € auf die Ausstattung zur Essensversorgung im engeren Sinne. Im Jahr 2006 wurden arbeitstäglich durchschnittlich 9 Frühstücke, 10 Mittagessen und 3 Abendessen verkauft. Die Mitversorgung der Ärzte durch das Mitarbeitercasino wäre problemlos möglich gewesen.
Die zahlreichen, größtenteils ohne Beachtung des Vergaberechts abgeschlossenen Verträge zur Patientenversorgung ließen kein Konzept der Geschäftsführung erkennen. Sie vermittelten den Eindruck der Federführung durch den Vertragspartner. Die Stiftung verfügte nicht über lückenlose Vertragsunterlagen und hatte keinen Überblick über die finanziellen Belastungen durch die Essensversorgung. Eine Kontrolle der abgerechneten Leistungen wurde von der Stiftung nicht durchgeführt. Für eine von einem Dritten eingeleitete, aber nicht abgeschlossene Ausschreibung von Küchenleistungen und für dessen Beratungsleistungen hat die Stiftung insgesamt rd. 149.000 € gezahlt. Nachprüfbare Unterlagen hierzu wurden dem Rechnungshof nicht vorgelegt.
Die Unterrichtung des Aufsichtsrats im Jahr 2002 durch den Geschäftsführer über ein voraussichtlich ausgeglichenes Ergebnis des Mitarbeitercasinos war nicht zutreffend. Für die Jahre 2002 bis 2006 ermittelte der Rechnungshof eine Unterdeckung zwischen jährlich rd. 120.000 € und rd. 179.000 €. Die Angaben der Stiftung hierzu waren wegen einer fehlenden aussagefähigen Kosten- und Leistungsrechnung nicht vollständig nachvollziehbar. Ein Teil der Unterdeckung war auf die kostenlose Versorgung einer Gruppe von Mitarbeitern mit Kaffee, Tee und Suppen zurückzuführen.
Durch eine grundlegende Neukonzeption der gesamten Essensversorgung und die Kostenerstattung aller gelieferten Speisen, Getränke und Lebensmittel könnten Abläufe optimiert und die Unterdeckung vermindert werden. Zudem sollte die Essensversorgung der Patienten ordnungsgemäß vergeben und vertraglich transparent geregelt werden. Die abgerechneten Leistungen müssen durch geeignete Kontrollmaßnahmen überwacht werden.
Die Stiftung beabsichtigt, die Essensversorgung so bald wie möglich dem Universitätsklinikum zu übertragen. Die gesonderte Essensausgabe für die Ärzte wurde eingestellt; das Ärztecasino wird künftig als Konferenzraum genutzt.
3.2.4 Wäscheversorgung
Bei der Vergabe der Waschleistungen, der Inanspruchnahme von Mietwäsche und der Einrichtung einer automatisierten Wäscheausgabe mit einem insgesamt beträchtlichen Finanzvolumen wurden die Vergabevorschriften missachtet; es entstanden vermeidbare Kosten. Wegen der unberechtigten Kündigung eines Vertrages über Waschleistungen musste die Stiftung für Schadenersatz, Anwalts- und Gerichtsgebühren insgesamt rd. 226.000 € zahlen. Die besondere Brisanz bei diesem Sachverhalt lag darin, dass der Kündigung eine wirtschaftliche Bewertung durch denjenigen Wäschelieferanten vorausging, mit dem der Folgevertrag abgeschlossen wurde.
Die Stiftung hatte keinen Überblick über die tatsächlichen Kosten der Wäscheversorgung und praktizierte ein mangelhaftes Wäschecontrolling. Wesentliche Daten wurden nur vom Lieferanten ermittelt und ausgewertet.
Die Stiftung prüft derzeit die Möglichkeit einer Übernahme der Wäscheversorgung und des Wäschecontrollings durch das Universitätsklinikum.
3.2.5 Arzneimittelversorgung
Bei der derzeitigen Arzneimittelversorgung wurden die Leistungen nicht ausgeschrieben, obwohl die maßgeblichen EU-Schwellenwerte überschritten waren.
Der Rechnungshof empfahl, die Apothekenleistungen zum nächstmöglichen Zeitpunkt auszuschreiben und dabei auch den medizinischen Sachbedarf und die Notfallversorgung einzubeziehen.
Nach Mitteilung der Stiftung soll die Arzneimittelversorgung ab 01.01.2009 durch die Apotheke des Universitätsklinikums erfolgen.
3.2.6 Investorenmodelle
Im Prüfungszeitraum wurden zwei Gebäudesanierungen als Investorenmodelle realisiert, die auf der Basis eines Erbbaurechts erfolgen sollten. Die dem Aufsichtsrat vorgelegten Vertragswerke wurden vom Finanzministerium und vom Wissenschaftsministerium als umständlich und unübersichtlich bewertet. Vorgeschlagene Änderungen wurden von der Stiftung nur ansatzweise umgesetzt. Teilweise wichen die abgeschlossenen Verträge von den Versionen ab, die den Ministerien vorgelegt worden waren. Vollständige Wirtschaftlichkeitsberechnungen wurden dem Aufsichtsrat nicht vorgelegt.
Allen abgeschlossenen Verträgen fehlte die erbbaurechtliche Grundlage. Das Grundbuchamt hatte den Antrag auf Anlegung eines Eigentümererbbaurechts zurückgewiesen, weil die zum Vollzug erforderlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren. Der Unternehmensleitung war es, trotz Nachfrist, nicht gelungen, die vom Grundbuchamt geforderten Voraussetzungen nachzuweisen.
Die Investoren mussten zur Finanzierung ihrer Sanierungsvorhaben Kredite aufnehmen. Diese sicherte die Stiftung mit zwei selbstschuldnerischen Bürgschaften in Höhe von insgesamt 1,9 Mio. € ab. Das wirtschaftliche Risiko der Kreditgeschäfte liegt derzeit immer noch bei der Stiftung, weil den Investoren das Erbbaurecht fehlt, mit dem sie eine eigene Absicherung der Kredite vornehmen sollten. Als Nachweis für das Einverständnis des Wissenschaftsministeriums mit den Bürgschaften legte der Geschäftsführer dem Rechnungshof die Kopien von zwei an das Ministerium adressierten E-Mails vor, die jedoch dort nicht bekannt waren. Für die Bürgschaften wäre die Zustimmung des Aufsichtsrates erforderlich gewesen.
Die Investoren waren nach den Verträgen verpflichtet, die Sanierung auf eigene Kosten vorzunehmen. Gleichwohl finanzierte die Stiftung in den Jahren 2003 und 2004 Aufwendungen der Investoren in Höhe von rd. 434.000 € zinslos vor, die später ersetzt wurden. Außerdem ist in der Buchhaltung der Stiftung ausgewiesen, dass die Stiftung Sanierungsaufwendungen übernommen hat, die die Investoren zumindest anteilig hätten tragen müssen; dazu gehören Honoraranteile der Investoren für Architektenleistungen sowie für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination von rd. 220.000 €.
Der Rechnungshof fordert, bei künftigen Projekten den Aufsichtsrat vollständig zu unterrichten, komplette Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu erstellen und die Verträge vereinbarungsgemäß zu vollziehen. Gegenüber den Investoren sind die von der Stiftung übernommenen Kosten geltend zu machen.
Die Stiftung hat eine Anwaltskanzlei mit der Klärung der vom Rechnungshof aufgeworfenen Fragen und mit der Prüfung eventueller Erstattungsansprüche beauftragt.
3.2.7 Dienstleistungsverträge für (bau)technische Leistungen
Die Stiftung beauftragte ab dem 01.05.2000 ein Ingenieurbüro (GmbH) u. a. mit Managementdienstleistungen für ihre Abteilung Technik. Der zum Zeitpunkt der Prüfung bis 31.12.2009 geltende Vertrag wurde am 24.08.2007 ohne ersichtlichen Grund um 10 Jahre bis 2017 verlängert. Die Managementdienstleistungen wurden vom Inhaber des Ingenieurbüros selbst erbracht. Zu den wesentlichen Aufgaben gehörte dabei die Beratung bei und die Beurteilung von Fragen im Technik- und Baubereich und den damit zusammenhängenden Ingenieurleistungen.
Bestandteil dieses Vertrages wurde im November 2000 eine Regelung, mit der demselben Ingenieurbüro u. a. das Recht eingeräumt wurde, Ingenieurleistungen für die Stiftung selbst zu erbringen. Damit war implizit die Vergabe von solchen Leistungen durch die Stiftung an das Ingenieurbüro geregelt. Dieser Vertragsteil war weder im zu erbringenden Leistungsumfang noch bei der Vergütungsregelung hinreichend bestimmt. Die vom Rechnungshof geprüften Leistungen hatten ein Volumen von mehr als 1 Mio. €. Sie waren ohne vorherige Ausschreibung erbracht und nicht durch entsprechende Nachweise belegt, teilweise wurden sie außerhalb des üblichen Gebührenrahmens vergütet.
Durch diesen Vertrag befand sich das Ingenieurbüro grundsätzlich in einem Interessenkonflikt. Nicht zuletzt deswegen bestand für die Stiftung ein hohes Risiko. Bei Vergabe, Durchführung, Kontrolle und Abrechnung der Ingenieurleistungen wirkte das Ingenieurbüro - und dabei maßgeblich dessen Inhaber - auf beiden Seiten des Auftragsverhältnisses mit. Wegen der unklaren und nachteiligen Vertragsgestaltung entstanden der Stiftung bei der Abwicklung von Ingenieurleistungen finanzielle Nachteile. Nach den bisherigen Berechnungen des Rechnungshofs wurden Honorare in Rechnung gestellt, die um 241.000 € über den einschlägigen Richtsätzen lagen.
Der Rechnungshof forderte, bei der künftigen Vergabe von Ingenieurleistungen die Bestimmungen des Vergaberechts zu beachten und Interessenkollisionen zu vermeiden. Die Verträge sollten eindeutige, transparente und wirtschaftlich vertretbare Regelungen enthalten.
Die Stiftung konnte inzwischen die Vertragsverlängerung bis 2017 einvernehmlich rückgängig machen. Eine Anwaltskanzlei wurde mit der Überprüfung der Angemessenheit der an das Ingenieurbüro geleisteten Zahlungen beauftragt.
4 Bewirtschaftung von Personalunterkünften
Bei der Bewirtschaftung der insgesamt 60 als Personalunterkünfte genutzten Appartements mangelte es an eindeutigen Vorgaben der Geschäftsführung. Es gab keine klare Zuständigkeitsregelung, keine nachvollziehbare Belegungsplanung und keine vollständige Dokumentation der Auslastung. Die Buchhaltung konnte den Eingang der Mietzahlungen nicht überwachen, da sie keine vollständigen Informationen über die Mieter und die zu entrichtende Miete erhielt.
Aus dem Betrieb der Personalunterkünfte erwirtschaftete die Stiftung im Jahr 2006 eine Unterdeckung von rd. 108.000 € und erreichte damit einen Deckungsgrad von 59 %. Von einigen Nutzergruppen wurden keine Mieten erhoben, beispielsweise von Doktoranden und von Referenten für in der Stiftung abgehaltene Seminare. Vereinzelt wurden auch Privatpersonen ohne Kostenersatz untergebracht. In einem Fall handelte es sich um Angehörige eines Bediensteten in leitender Position.
Der Rechnungshof forderte die Stiftung auf, grundsätzlich zu prüfen, ob eigene Personalunterkünfte noch erforderlich sind. Wenn weiter Personalunterkünfte betrieben würden, müssten sämtliche Verwaltungsabläufe optimiert und die Buchhaltung in die Lage versetzen werden, die Mieterlöse vollständig zu erheben. Eine kostenlose Unterbringung sollte nur in berechtigten Ausnahmefällen erfolgen. Von externen Nutzern seien grundsätzlich kostendeckende Mieten zu erheben.
Die Stiftung will Personalunterkünfte auch künftig vorhalten. Sie strebt eine Verbesserung des Deckungsgrades an und prüft die Erhöhung der Miete für externe Nutzer. Die Verwaltungsabläufe wurden verbessert, die Buchhaltung kann künftig alle Mieteingänge kontrollieren. Eine kostenlose Unterbringung soll nur noch in berechtigten Einzelfällen erfolgen.
5 Schlussbemerkung
Die Prüfung des Rechnungshofs hat gravierende Mängel in der Unternehmensführung aufgezeigt. Aus der mangelhaften Arbeit weniger Bediensteter in leitender Funktion ergaben sich für die Stiftung erhebliche finanzielle Nachteile, die sich nach den Berechnungen des Rechnungshofs auf 1,2 Mio. € belaufen.
Die Stiftung und das Wissenschaftsministerium haben die Feststellungen und Empfehlungen des Rechnungshofs aufgegriffen und eine Optimierung der betrieblichen Abläufe sowie Maßnahmen für eine Verbesserung der Kosten-situation bereits vollzogen bzw. eingeleitet. Wesentlich dazu beitragen dürften die schon veranlasste Trennung der Stiftung von den verantwortlichen Bediensteten und die Übertragung der Geschäftsführung der Stiftung ab 01.01.2008 auf das Universitätsklinikum. Die Staatsanwaltschaft hat auf Anregung des Wissenschaftsministeriums ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Ministerium strebt an, die Stiftung zum 01.01.2009 in das Universitätsklinikum einzugliedern.
Unabhängig davon hält der Rechnungshof die vollständige Bereinigung der aufgezeigten Mängel und die Umsetzung seiner Empfehlungen für erforderlich.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Das neue, stärker leistungsorientierte Besoldungssystem für Professoren (W-Besoldung) ist im Wesentlichen praktikabel und kann seine Ziele erreichen. Der Rechnungshof empfiehlt deshalb dem jetzt zuständigen Landesgesetzgeber, dieses System mit einer Reihe von Korrekturen zu übernehmen.
1 Professorenbesoldung nach altem Recht (C-Besoldung)
Bis zum 31.12.2004 wurden bundesweit alle Professoren an Fachhochschulen nach den Besoldungsgruppen C 2 und C 3 besoldet.
Es handelte sich dabei um ein Grundgehalt, das sich regelmäßig alle zwei Jahre um eine Altersstufe erhöhte und durch den Familienzuschlag ergänzt wurde. Die höchste Altersstufe erreichte ein Fachhochschulprofessor in der Regel im 49. Lebensjahr, danach gab es keine weiteren Altersstufen mehr. Leistungselemente oder Zuschüsse waren bei Fachhochschulprofessoren nicht vorgesehen.
An den baden-württembergischen Fachhochschulen waren im Stellenplan in der Regel 40 % der Stellen in der Besoldungsgruppe C 2 und 60 % der Stellen in der Besoldungsgruppe C 3 ausgewiesen. Die meisten Professoren wurden als C 2-Professoren berufen und wechselten im Laufe ihrer Dienstzeit in die höhere Besoldungsgruppe C 3, wobei der Wechsel häufig dem Prinzip der Seniorität folgte.
Für die hauptamtlichen Funktionsstellen im Bereich der Hochschulleitung waren nach altem Recht spezielle Stellen vorgesehen, die den Besoldungsordnungen A und B zugewiesen waren.
2 Professorenbesoldung nach neuem Recht (W-Besoldung)
Durch eine Änderung des Bundesbesoldungsgesetzes wurde mit Wirkung vom 01.01.2005 bundesweit die Besoldung der Professoren an allen Hochschulen neu geregelt: An die Stelle der Besoldungsgruppen C 1 bis C 4 traten die Besoldungsgruppen W 1 bis W 3, für Professoren an Fachhochschulen sind seither die Besoldungsgruppen W 2 und W 3 vorgesehen.
Diese neuen Besoldungsgruppen sehen ein gegenüber der C-Besoldung geringeres altersunabhängiges Grundgehalt vor, erlauben aber die Vergabe von Leistungsbezügen nach einem stark ausdifferenzierten System, das durch den Landesgesetzgeber noch weiter verfeinert wurde.
So können die Fachhochschulprofessoren (wie alle Professoren) folgende vier Arten von Leistungsbezügen bzw. Zulagen erhalten:
1. Leistungsbezüge, die aus Anlass einer Berufung oder einer Bleibeverhandlung gewährt werden. Damit wird diese bei Universitätsprofessoren traditionell gegebene und vielfach genutzte Möglichkeit auch auf den Bereich der Fachhochschulen ausgedehnt. So können Fachhochschulen die Einstiegsgehälter ihrer Professoren individuell nach Qualifikation, Fach und Bewerberlage differenzieren.
2. Leistungsbezüge für besondere Leistungen in Forschung, Lehre und Weiterbildung. Diese Leistungsbezüge können vom Vorstand der Hochschule als Einmalzahlung oder befristet, bei wiederholter Vergabe auch unbefristet vergeben werden, um damit Leistungen der Professoren im Hauptamt zu honorieren.
3. Leistungsbezüge für die Wahrnehmung von Funktionen und Leitungsaufgaben innerhalb der Hochschule. Sie werden für die Dauer der Wahrnehmung der Funktion oder Aufgabe gewährt. Sie können sowohl für die hauptamtlichen Führungsfunktionen als auch für nebenamtliche Funktionen vergeben werden.
4. Forschungs- und Lehrzulagen, die aus Mitteln Dritter finanziert werden. Damit können materielle Anreize für Professoren geschaffen werden, Drittmittel für die eigene Hochschule einzuwerben, und nicht aus materiellem Interesse auf Nebentätigkeiten auszuweichen.
Um zu verhindern, dass bei der Besoldung der Professoren und der Gewährung von Leistungsbezügen fiskalische Gesichtspunkte vernachlässigt werden, muss jede Hochschule einen Vergaberahmen einhalten, aus dem sich die Verfügungsmasse für die Gewährung von Leistungsbezügen errechnen lässt. Basis hierfür ist ein Besoldungsdurchschnitt, der für die Fachhochschulen derzeit 63.850 € (je Jahr) beträgt.
Das neue Besoldungsrecht findet auf alle Professoren Anwendung, die nach dem 01.01.2005 in ihr Amt berufen wurden. Für Professoren, die vor dem 01.01.2005 berufen worden sind, finden weiterhin die Regeln des alten Besoldungsrechts (C-Besoldung) Anwendung, es sei denn, der einzelne Professor optiert für einen Wechsel ins neue Besoldungsrecht. Um die Entscheidung zu erleichtern, dürfen dem für das neue Recht optierenden Professor dynamisierte Wechselleistungsbezüge gewährt werden, deren Höhe allerdings vom Gesetzgeber begrenzt wurde.
3 Zuständigkeit des Landesgesetzgebers und Prüfung des Rechnungshofs
Mit der Föderalismusreform ist die Zuständigkeit für das Recht der Besoldung und Versorgung der Beamten auf das Land übergegangen. Der Landesgesetzgeber wird daher in den nächsten Monaten entscheiden, wie die Besoldung und Versorgung der Professoren in Zukunft gestaltet werden sollen, welche der bundesrechtlichen Regelungen sich bewährt haben und übernommen werden und in welchen Bereichen neue Regelungen erforderlich sind.
Aus Anlass dieses bevorstehenden Gesetzgebungsverfahrens hat der Rechnungshof die Umsetzung der neuen Professorenbesoldung an den Fachhochschulen des Landes geprüft und auf der Basis dieser Prüfung Empfehlungen für die neue Gesetzgebung formuliert.
4 Die Vorteile des neuen Besoldungssystems
Wie die Erhebungen gezeigt haben, kann das neue Besoldungsrecht seine Ziele erreichen. Die Vorstände der Fachhochschulen haben die Möglichkeit, eine strategisch fundierte und individuell differenzierte Personalpolitik zu betreiben. Sie ermöglicht ein leistungsfreundliches Klima, in dem jeder Professor während der gesamten Dauer seiner Amtszeit Anreize für besondere Leistungen in Forschung, Lehre und Weiterbildung erhält.
Jede Hochschule hat die Möglichkeit, im gesetzlichen Rahmen eigene Akzente zu setzen und ein auf das Profil der Hochschule zugeschnittenes System der leistungsorientierten Besoldung zu schaffen. Tatsächlich haben die Hochschulen von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, indem sie jeweils eigene Richtlinien erlassen haben.
Durch die Möglichkeit, bei Berufungsverhandlungen Leistungsbezüge zu gewähren, können die Hochschulen ihre Einstiegsgehälter auf das jeweilige Fachgebiet, den jeweiligen Bewerber und die jeweilige Marktlage passgenau zuschneiden. Da ein Viertel der Professorenstellen in der Besoldungsgruppe W 3 ausgeschrieben und besetzt werden kann, öffnet sich den Fachhochschulen ein zusätzliches Reservoir für die Gewinnung hoch qualifizierter Wissenschaftler als Professoren.
Die Gewährung attraktiver Funktionsleistungsbezüge schafft Anreize für Professoren, Führungsverantwortung innerhalb der Hochschule zu übernehmen.
Durch die verbindliche Vorgabe eines Vergaberahmens für die Professoren einer Hochschule wird gesichert, dass materielle Gruppeninteressen nicht die Oberhand über die strategischen Interessen der Hochschule und das fiskalische Interesse des Landes gewinnen. Der Vergaberahmen begrenzt zwar die Gestaltungsfreiheit des Hochschulvorstands, ist aber das Fundament, auf dem sich die Flexibilität und Gestaltungsfreiheit der Hochschulen entfalten kann.
Die Möglichkeit, außerhalb des Vergaberahmens Forschungs- und Lehrzulagen aus eingeworbenen Drittmitteln zu vergeben, schafft für den einzelnen Fachhochschulprofessor einen materiellen Anreiz, Drittmittelprojekte für die Hochschulen einzuwerben und als Teil des Hauptamtes an der Hochschule zu betreuen. Damit wird das Forschungsprofil der Hochschule gestärkt und der Anreiz reduziert, Drittmittel in private Nebentätigkeiten umzulenken.
Sinnvoll eingesetzt ermöglicht das neue Besoldungsrecht gerade den Fachhochschulen, ihr Profil in Lehre und Forschung zu schärfen und durch die Vorgabe von Leistungszielen die Entwicklung der Hochschule strategisch zu lenken. Durch die bei Einführung der W-Besoldung vorgenommene Erhöhung des Besoldungsdurchschnitts und die vergleichsweise großzügige Ausgestaltung der Ruhegehaltfähigkeit der Leistungsbezüge haben sich zugleich die Einkommensmöglichkeiten der Fachhochschulprofessoren deutlich verbessert.
Für die einzelnen Professoren hat das neue Recht den Vorteil, dass die erzielbaren Einkommen nicht wie im alten System nach oben begrenzt sind. Bei entsprechenden Leistungen kann jetzt ein Besoldungsniveau erreicht werden, das über dem Niveau der bisherigen Besoldungsgruppe C 3 liegt.
5 Defizite des neuen Besoldungsrechts und seiner Umsetzung
Die Prüfung hat allerdings auch eine Reihe von Defiziten ergeben, die das neue Recht und seine Umsetzung durch die Fachhochschulen aufweisen.
5.1 Jahrzehntelanges Nebeneinander von C-Besoldung und W-Besoldung
Mehr als 90 % der vor dem 01.01.2005 berufenen Professoren haben bis Ende 2007 von der Möglichkeit, ins neue Besoldungssystem zu wechseln, keinen Gebrauch gemacht. Die Ursachen sind vielfältig. Sie reichen von schlichtem Unverständnis und generellem Misstrauen gegen das neue System über die Absicht, sich dem System der Leistungsbeurteilung zu entziehen, bis hin zu der fehlenden Bereitschaft, auch nur zeitweise Einkommenseinbußen hinzunehmen.
An allen Fachhochschulen werden - bei unveränderter Rechtslage - über viele Jahre Professoren aus beiden Systemen nebeneinander forschen und lehren. Der mit der W-Besoldung verbundene Kulturwechsel wird deshalb nur allmählich eintreten. Außerdem erhöht das Nebeneinander von Altersstufen und Leistungsbezügen den Transaktionsaufwand.
5.2 Zögerliche Umsetzung der Möglichkeiten des neuen Rechts durch die Fachhochschulen
Nach dem Ergebnis der Prüfung machen die meisten Fachhochschulen von den Möglichkeiten des neuen Rechts noch eher zögerlich Gebrauch. Es gibt mehrere Ursachen für diese abwartende Haltung:
- Das Nebeneinander von C- und W-Besoldung führt dazu, dass die Hochschulen zur Deckung der kommenden Altersstufen im Rahmen der C-Besoldung Teile des Vergaberahmens zurückhalten, um in den Folgejahren nicht in die Gefahr zu geraten, den vorgegebenen Vergaberahmen zu überschreiten. Dieses Geld fehlt heute bei der Vergabe von Leistungsbezügen.
- Die Gestaltungs- und Differenzierungsmöglichkeiten der Einstiegsgehälter bei neu berufenen Professoren werden von einigen Hochschulen nicht genutzt, weil Gleichbehandlungsmaximen oder die Angst vor dem Neid der etablierten Professoren über das strategische Interesse an einer differenzierten Gehaltspolitik dominieren.
- Die nach dem neuen Recht zur Verfügung stehenden attraktiven W 3-Stellen werden nur zurückhaltend ausgeschrieben, weil befürchtet wird, das Gleichgewicht innerhalb des Professorenkollegiums könne durch die Berufung von W 3-Professoren gestört werden.
Als Konsequenz der abwartenden Haltung der Hochschulen beginnen die Vorteile des neuen Systems nur allmählich zu wirken. Durch die Zurückhaltung von Teilen des Vergaberahmens wird die motivierende Funktion des neuen Systems gemindert. Die Möglichkeit, durch gezielte Besetzung von W 3-Stellen das Profil der einzelnen Hochschule zu schärfen, wird zu wenig genutzt.
5.3 Unzureichende Akzeptanz des neuen Systems bei den früher berufenen Professoren
Bei den früher berufenen Professoren findet das neue Besoldungssystem nur begrenzt Akzeptanz.
Ein wesentlicher Einwand gegen das neue System ist dabei, dass den vor 2005 berufenen Professoren der damals in Aussicht gestellte Aufstieg von C 2 nach C 3 durch das neue Recht unmöglich gemacht worden ist.
Die hohe Komplexität und Intransparenz des neuen Rechts, der Übergangsregelungen und zum Teil auch der von den Hochschulen beschlossenen Richtlinien sind ebenfalls ein beachtliches Hindernis für die vorbehaltlose Hinnahme des neuen Besoldungssystems.
Diese Akzeptanzdefizite behindern den Kulturwandel, provozieren unnötige Konflikte und tragen dazu bei, dass die Mehrzahl der Professoren die Sicherheit des bisherigen Besoldungssystems den Chancen des neuen Systems vorzieht.
5.4 Komplexe und intransparente Regelung der Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen
Das geltende Recht regelt die Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen in hoch komplexer, für die Beteiligten bisweilen schwer zu durchschauender Weise und nimmt dabei im Detail auch noch Wertungswidersprüche hin, die den Zweck des Gesetzes konterkarieren.
Diese komplizierte Regelung ist weder sachlich geboten noch dient sie der Akzeptanz des neuen Besoldungsrechts. Außerdem wird sie mittelfristig zu einem erhöhten Verwaltungsaufwand und zu einer erhöhten Fehleranfälligkeit bei der Festsetzung der Ruhegehälter führen.
Der Landesgesetzgeber kann jetzt selbst ein einfaches, für alle Beteiligten leicht zu durchschauendes System schaffen.
6 Empfehlungen des Rechnungshofs
Vor dem Hintergrund der bei der Prüfung getroffenen Feststellungen empfiehlt der Rechnungshof:
6.1 Übernahme der W-Besoldung ins neue Landesbesoldungsrecht
Das seit 01.01.2005 geltende System der W-Besoldung mit seinen vergleichsweise geringeren Grundgehältern und hohen leistungsbezogenen Anteilen kann sich zu einem geeigneten Instrument zur Herausbildung einer strategisch orientierten und individuell differenzierten Personalpolitik der Fachhochschulen weiter entwickeln.
Auf der Basis seiner Prüfungsfeststellungen empfiehlt der Rechnungshof, dieses System auch im neuen Landesbesoldungsrecht für Professoren vorzusehen.
Die Möglichkeit, das System der leistungsorientierten Besoldung der Professoren durch Richtlinien auf das Profil der jeweiligen Hochschule zuzuschneiden und damit ein Stück Wettbewerb der Hochschulen um die besten Bewerber zu schaffen, sollte erhalten bleiben.
6.2 Keine Erhöhung der Grundgehälter W 2 und W 3 sowie des Besoldungsdurchschnitts
Die Prüfung hat ergeben, dass die Höhe der Grundgehälter der Besoldungsgruppen W 2 und W 3 kein Hindernis ist, um zusammen mit den jetzt möglichen individuell gestaltbaren Berufungsleistungsbezügen qualifizierte Bewerber für frei werdende Professorenstellen zu gewinnen.
Einen nachvollziehbaren Grund, diese Grundgehälter jetzt anzuheben, sieht der Rechnungshof nicht, zumal diese Maßnahme bei gegebenem Vergaberahmen zu einer Reduzierung der leistungsbezogenen Besoldungsbestandteile führen würde.
Auffällig ist die große Zurückhaltung der Fachhochschulen bei der Ausschreibung und Besetzung von W 3-Stellen.
Der Rechnungshof hat auch keine Gesichtspunkte feststellen können, die für eine Anhebung des gegenwärtig auf 63.850 € festgesetzten Besoldungsdurchschnitts sprechen würden. Es handelt sich um den zweithöchsten Besoldungsdurchschnitt aller Bundesländer. Im Übrigen wird der Vergaberahmen von der Mehrzahl der baden-württembergischen Hochschulen gegenwärtig gar nicht vollständig ausgeschöpft.
6.3 Verbot der Hausberufungen erhalten
Die durch das neue Landeshochschulgesetz weitgehend ausgeschlossene Berufung hauseigener Bewerber auf besser besoldete Professorenstellen (also W 3-Stellen) sollte beibehalten werden. Anderenfalls droht die Gefahr, dass die strategische Funktion der W 3-Stellen entwertet wird und - wie im alten System - ein egalitärer Automatismus an die Stelle einer leistungsorientierten Besoldung tritt.
Das Recht der W-Besoldung gibt über die nach oben weit offenen Leistungsbezüge ausreichend Möglichkeiten, einen leistungsstarken Professor auch ohne Hausberufung angemessen zu besolden.
6.4 Überleitung aller C 2-Professoren nach Besoldungsgruppe W 2 kraft Gesetzes
Der Gesetzgeber sollte nach Auffassung des Rechnungshofs auch dafür sorgen, dass das Nebeneinander von C- und W-Besoldung schneller beendet werden kann. In Betracht kommt dafür die gesetzliche Überleitung aller nach C 2 besoldeten Professoren in die W-Besoldung, dabei könnte der notwendige Vertrauensschutz gewährleistet werden, indem die betroffenen Professoren dynamisierte Wechselleistungsbezüge erhalten, die exakt der Differenz zwischen dem bisher bezogenen Grundgehalt der Besoldungsgruppe C 2 und dem Grundgehalt der Besoldungsgruppe W 2 entsprechen.
Die gesetzliche Überleitung sollte so geregelt werden, dass ab dem Zeitpunkt der Überleitung keine Altersstufen mehr gewährt würden. Die übergeleiteten Professoren würden dann wie alle anderen Professoren der W-Besoldung an der hochschulinternen Leistungsbewertung und der Vergabe von Leistungsbezügen teilnehmen.
6.5 Keine Überleitung der C 3-Professoren, aber Möglichkeit zum Bezug von Forschungs- und Lehrzulagen aus Drittmitteln
Da die weit überwiegende Zahl der C 3-Professoren bereits in der höchsten Altersstufe ihrer Besoldungsgruppe angelangt ist und damit alle Vorteile des bisherigen Systems in Anspruch genommen hat, sollte für diese Gruppe von einer Überleitung kraft Gesetzes abgesehen werden.
Als einzige Neuerung sollte für diese Gruppe die Möglichkeit eingeführt werden, befristete Forschungs- und Lehrzulagen aus Drittmitteln zu erhalten. Damit wird auch bei dieser Gruppe von Professoren ein Anreiz dafür geschaffen, lukrative Drittmittelaufträge nicht als Nebentätigkeit, sondern im Hauptamt auszuführen, was regelmäßig dem Interesse der Hochschule und des Landes entspricht.
6.6 Vereinfachung der Vergabe von unbefristeten Leistungsbezügen
Die Leistungsbezüge für besondere Leistungen in Forschung, Lehre und Weiterbildung können abweichend von der bisherigen Regelung sofort unbefristet vergeben werden. Das heute geltende System von zunächst befristeter Vergabe und anschließender Entfristung verursacht einen hohen Transaktionsaufwand, verunsichert die Beteiligten und bringt fiskalisch in der Regel keinen Vorteil, da bis zum Eintritt in den Ruhestand die Leistungsbezüge regelmäßig entfristet oder nach zehnjähriger Bezugsdauer ruhegehaltfähig werden.
Um den Vergaberahmen nicht weiter als erforderlich zu schmälern, sollten Leistungsbezüge auch künftig in der Regel nicht dynamisiert vergeben werden dürfen. Ausnahmen sollten für die Wechselleistungsbezüge und können für die Funktionsleistungsbezüge gelten.
6.7 Vereinfachung der Ruhegehaltfähigkeit
Das System der Ruhegehaltfähigkeit der Leistungsbezüge sollte grundlegend vereinfacht werden und dabei folgenden Leitlinien folgen:
- Alle unbefristeten Leistungsbezüge sollten nach dreijährigem Bezug ruhegehaltfähig werden, soweit sie 40 % des jeweiligen Grundgehalts nicht übersteigen.
- Alle befristeten Leistungsbezüge sollten nicht ruhegehaltfähig sein, gleich wie lange sie bezogen worden sind.
- An die Stelle der Ruhegehaltfähigkeit der Funktionsleistungsbezüge könnte für hauptamtliche Vorstandsmitglieder eine Zulage zur Versorgung treten, deren Höhe sich an den vollendeten Amtsjahren orientiert.
Die nebenamtliche Führungsfunktion muss sich nicht in der Altersversorgung niederschlagen.
7 Stellungnahme der Ministerien
Da die Prüfung des Rechnungshofs erst im März 2008 abgeschlossen worden ist, haben das Finanzministerium und das Wissenschaftsministerium zu den Empfehlungen noch nicht ausführlich Stellung genommen.
In einer ersten kurzen Stellungnahme haben beide Ministerien darauf hingewiesen, dass die Empfehlungen des Rechnungshofs im Zuge des anstehenden Gesetzgebungsverfahrens zur Dienstrechtsreform im Einzelnen geprüft werden sollen. Sie beabsichtigten, an den Grundsätzen der W-Besoldung festzuhalten und nur die notwendigen Korrekturen vorzunehmen. Strukturelle Änderungen seien nicht vorgesehen.
Bedenken machen die beiden Ministerien insbesondere gegen die gesetzliche Überleitung der Professoren der Besoldungsgruppe C 2 in die Besoldungsgruppe W 2, gegen die Einführung einer Lehr- und Forschungszulage auch für Professoren in der C-Besoldung und gegen die vorgeschlagene Versorgungszulage für Funktionsträger geltend.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Die Exportakademie Baden-Württemberg in Reutlingen erwirtschaftet jedes Jahr ein beträchtliches Defizit. Der Rechnungshof schlägt vor, die Exportakademie in eine andere Trägerschaft zu überführen oder zu schließen. Die Export-Akademie an der Hochschule Karlsruhe arbeitet im Wesentlichen kostendeckend. Allerdings muss dort in Zukunft das Nebentätigkeitsrecht beachtet werden.
1 Entwicklung der Exportakademien
Die Exportakademie Baden-Württemberg wurde im Jahr 1984 als unselbstständige Anstalt und wissenschaftliche Einrichtung der Fachhochschule Reutlingen gegründet. Ihr Angebot als Weiterbildungseinrichtung für das Auslandsgeschäft gliederte sich damals in einen Aufbaustudiengang „Internationales Marketing“ und in Weiterbildungskurse für Berufstätige auf dem Gebiet der Exportwirtschaft.
Eine Prüfung des Rechnungshofs im Jahr 1992 zeigte Probleme beim Betrieb der Exportakademie auf, die ihre Wirtschaftlichkeit, die Abgrenzung von Haupt- und Nebentätigkeiten und die Vergütung des Lehrpersonals betrafen. Ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Tübingen im Jahr 1996 wegen des Verdachts falscher Abrechnungen führte ebenfalls zu kritischen Feststellungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Exportakademie.
Auch als Konsequenz aus den zutage getretenen Problemen beschloss die Landesregierung im Jahr 1998 eine Neuorganisation der Exportakademie. Der Aufbaustudiengang, bis dahin eines der zentralen Angebote der Akademie, wurde einschließlich des damit verbundenen Fernlehrangebots in das reguläre Studienangebot der Fachhochschule Reutlingen eingegliedert. Der verbleibende Weiterbildungsbereich für Nichtstudierende wurde in einen Landesbetrieb umgewandelt und trägt seither den Namen „Exportakademie Baden-Württemberg“.
Zugleich wurde von der Landesregierung die Erwartung formuliert, dass die Exportakademie dauerhaft ohne Defizit arbeiten sollte.
Seit 2005 erhält die Exportakademie keine Landeszuschüsse mehr, die entstandenen Defizite werden jeweils aus den Haushaltsresten gedeckt, die die Exportakademie in den Jahren 1999 bis 2004 gebildet hat. Die Außenstelle Karlsruhe der Exportakademie Baden-Württemberg wurde zum Ende des Jahres 2004 geschlossen.
Die Exportakademie verfügt über 5,5 Personalstellen, die allerdings teilweise nicht besetzt sind. Außerdem werden aus Projektmitteln befristete Arbeitsverhältnisse finanziert. Insgesamt umfasste das Personal der Exportakademie in Reutlingen zum Zeitpunkt der Prüfung des Rechnungshofs 6,2 Vollzeitäquivalente (VZÄ).
Im Jahr 2006 standen Erträgen von 771.000 € Aufwendungen in Höhe von 914.000 € gegenüber.
Der Hochschulrat der Hochschule Reutlingen hat sich im Jahr 2006 für eine Schließung der Exportakademie ausgesprochen; das Präsidium der Hochschule ist diesem Beschluss bis heute nicht gefolgt.
Gegenstand der Prüfung des Rechnungshofs war die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Exportakademie; zeitgleich wurde die Export-Akademie an der Hochschule Karlsruhe geprüft.
2 Das Weiterbildungsangebot der Exportakademie Baden-Württemberg in Reutlingen
Das Weiterbildungsangebot der Exportakademie setzt sich aus vier Teilen zusammen:
2.1 SEFEX-Seminare
Es handelt sich um ein Seminarangebot, das sich an Angehörige kleiner und mittlerer Unternehmen richtet, die im Auslandsgeschäft tätig sind. Das Themenspektrum reicht von der Abwicklung von Exportgeschäften über Finanz- und Vertragsfragen bis hin zu speziellen Länderseminaren, die sich mit den Besonderheiten des Exports in diese Länder auseinandersetzen.
Im Jahr 2006 fanden 12 solcher Seminare statt, die von insgesamt 95 Teilnehmern besucht wurden. Im Jahr 2007 ging die Teilnehmerzahl auf 62 zurück.
Die SEFEX-Seminare erbrachten im Zeitraum 2004 bis 2006 eine Unterdeckung von insgesamt 95.000 €.
2.2 Zertifikatslehrgang Auslandsreferent (ZIM)
Bei dem Zertifikatslehrgang ZIM handelt es sich um ein Fernlehrangebot für Berufstätige, das neben zahlreichen Studienbriefen 18 Wochenendpräsenzphasen und ein einwöchiges Unternehmensplanspiel umfasst. Die Teilnehmer können entweder den ganzen Lehrgang absolvieren, der dann zum Zertifikat „Auslandsreferent (Exportakademie)“ führt, oder einzelne Module belegen.
Im Jahr 2006 haben insgesamt 44 Teilnehmer einzelne oder mehrere Module des Zertifikatslehrgangs belegt. Durchschnittlich wurde jedes Modul von 14 Teilnehmern wahrgenommen.
Der Zertifikatslehrgang erbrachte im Zeitraum von 2004 bis 2006 eine Unterdeckung von 251.863 €.
2.3 Internationales Management-Institut (IMI)
Seit 1991 besteht an der Exportakademie ein „Internationales Management-Institut“, das Weiterbildungsangebote für Zielgruppen aus Osteuropa und aus Entwicklungsländern anbietet, deren Kosten in der Regel aus öffentlichen Drittmitteln gedeckt werden.
Im Jahr 2006 handelte es sich um fünf Weiterbildungsprojekte mit insgesamt mehr als 100 Teilnehmern. Mit den IMI-Projekten wurde ein Deckungsbeitrag für die Exportakademie von 66.786 € erwirtschaftet. Der hohe volkswirtschaftliche Nutzen dieser Projekte wurde vom Bundesminister für Wirtschaft und Technologie in einer Studie bestätigt.
2.4 Ergänzungsstudium für Spätaussiedler
Im Auftrag der Otto Benecke Stiftung e.V. bietet die Exportakademie seit 1988 ein Ergänzungsstudium für Spätaussiedler an, mit dessen Hilfe diese beruflich und gesellschaftlich in das Wirtschaftsleben der Bundesrepublik Deutschland integriert werden sollen.
Obwohl dieses Ergänzungsstudium vom Bund und von der Europäischen Union gefördert wird, erwirtschaftete die Exportakademie in den Jahren 2004 bis 2006 auch in diesem Bereich eine Unterdeckung von 77.542 €.
2.5 Bewertung
Mit diesen Weiterbildungsangeboten wird die Exportakademie ihrer ursprünglichen Zielsetzung nicht mehr gerecht. Die seit Gründung der Einrichtung angebotenen Weiterbildungskurse auf dem Gebiet der Exportwirtschaft finden immer weniger Interessenten. Die übrigen Angebote sind ein Konglomerat von eher zusammenhanglosen Einzelbausteinen, das in weiten Teilen von öffentlichen Drittmitteln abhängig ist.
3 Die wirtschaftliche Situation der Exportakademie Baden-Württemberg in Reutlingen
3.1 Entwicklung der Jahresfehlbeträge
Mit der Umwandlung der Exportakademie in einen Landesbetrieb zum 01.01.1999 verband die Landesregierung die Erwartung, dass die Exportakademie innerhalb von fünf Jahren ihr Betriebskostendefizit vollständig abbaut und ab 2004 kein Landeszuschuss mehr erforderlich sein würde. Grundlage dieser Erwartung war die Überzeugung, dass eine Einrichtung der wissenschaftlichen Weiterbildung in der Regel kostendeckend arbeiten sollte. Tatsächlich gewährt das Land seit Beginn des Jahres 2005 keinen Zuschuss mehr für den Betrieb der Exportakademie.
Zwar ist es der Exportakademie seit ihrer Umwandlung in einen Landesbetrieb gelungen, den von ihr erwirtschafteten Fehlbetrag deutlich zu reduzieren, jedoch betrug der Fehlbetrag in den Jahren 2005 und 2006 jeweils noch nahezu 150.000 €.
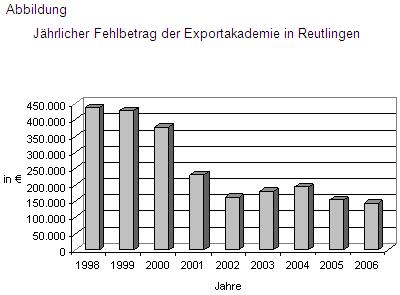
Seit 2005 werden diese Fehlbeträge aus den Haushaltsresten der Vorjahre gedeckt. Spätestens ab 2009 stehen zur Deckung des Jahresfehlbetrages keine Haushaltsmittel mehr zur Verfügung.
Ursache der Fehlbeträge sind einerseits die Fixkosten für das bei der Exportakademie unbefristet beschäftigte Personal, die regelmäßig nicht vollständig in die Kalkulation der Veranstaltungspreise eingegangen sind, andererseits die Schwierigkeit, in einem gewandelten Weiterbildungsmarkt, in dem die Nachfrage schwankt und die Zahl der Angebote steigt, die auf der Grundlage von Vollkosten kalkulierten Preise durchzusetzen. Die Leitung der Exportakademie macht geltend, dass die derzeit verlangten Teilnahmegebühren schon an der Obergrenze des Marktüblichen lägen. Im Bereich der öffentlichen Drittmittelprojekte konkurriere man mit Einrichtungen anderer Bundesländer, die von diesen subventioniert würden.
3.2 Bewertung der wirtschaftlichen Situation
Die von der Exportakademie ausgewiesenen Jahresfehlbeträge wären noch höher anzusetzen, wenn alle Leistungen, die die Hochschule Reutlingen gegenüber der Exportakademie teilweise unentgeltlich erbringt, von der Exportakademie angemessen vergütet werden müssten.
Dies gilt insbesondere für die Verwertung von Studienbriefen des von der Hochschule angebotenen Aufbaustudiengangs „Internationales Marketing“ im Rahmen des Zertifikatslehrgangs, ohne dass dafür Lizenzgebühren oder Ähnliches entrichtet werden müssen.
Es wäre nicht zu verantworten, dass eine Hochschule aus den für Studium und Lehre vorgesehenen Haushaltsmitteln dauerhaft eine defizitäre Weiterbildungseinrichtung subventioniert. Diese Einrichtungen müssen so betrieben werden, dass die entstehenden Kosten gedeckt werden und im Regelfall sogar ein Deckungsbeitrag zu den Kosten der Hochschule entsteht.
Dies gilt umso mehr, als die Landesregierung genau aus diesem Grund den Landeszuschuss für diese Einrichtung zum 31.12.2004 eingestellt hat.
Es müssen daher Maßnahmen ergriffen werden, um den defizitären Betrieb der Exportakademie möglichst zeitnah zu beenden.
4 Empfehlungen zur Exportakademie Baden-Württemberg
Der Rechnungshof empfiehlt, die Exportakademie an der Hochschule Reutlingen nicht weiterzuführen.
Dafür bieten sich alternativ drei Wege an:
4.1 Angliederung der Exportakademie an andere öffentliche Träger
Die Exportakademie Baden-Württemberg könnte von einer anderen öffentlichen Einrichtung übernommen und unter dem eingeführten Namen, allerdings unter anderen betriebswirtschaftlichen Vorzeichen, weitergeführt werden.
In Betracht kommen dafür insbesondere die Industrie- und Handelskammern in Baden-Württemberg, die ebenfalls Qualifizierungsangebote für Mitarbeiter exportierender Unternehmen anbieten.
Eines Zuschusses aus dem Landeshaushalt oder aus dem Haushalt der Hochschule Reutlingen bedürfte es dann nicht mehr.
4.2 Übernahme der Einrichtung durch Private
Fiskalisch wünschenswert wäre eine Lösung, bei der ein privates Unternehmen die Exportakademie Baden-Württemberg übernehmen und einzelne ihrer Angebote weiterführen würde.
Zweifelhaft ist allerdings, ob ein privates Unternehmen bereit wäre, das an der Akademie vorhandene Personal zu übernehmen.
4.3 Auflösung der Exportakademie
Wenn weder die Angliederung an eine bestehende öffentliche Einrichtung noch die Privatisierung der Exportakademie Baden-Württemberg gelingen sollte, dann muss die Einrichtung geschlossen werden. Für das auf den Stellen der Exportakademie beschäftigte Personal sollten andere Verwendungen an der Hochschule Reutlingen oder in der Landesverwaltung gefunden werden.
5 Export-Akademie an der Hochschule Karlsruhe
Bis zum Jahr 2004 bestand an der Hochschule Karlsruhe eine Außenstelle der Exportakademie Baden-Württemberg, die damals im Zuge der Neuorganisation der Exportakademie geschlossen wurde.
Die Hochschule Karlsruhe hat daraufhin als Teil ihrer eigenen Weiterbildungseinrichtung die vormals angebotenen SEFEX-Seminare wieder aufgenommen und für dieses Seminarangebot den leicht modifizierten Namen „Export-Akademie“ verwendet. Namensrechtliche Bedenken der Hochschule Reutlingen wurden von der Hochschule Karlsruhe zurückgewiesen und blieben bis heute unberücksichtigt.
5.1 Feststellungen zur wirtschaftlichen Situation
Der Rechnungshof hat im Zuge seiner Prüfung auch die Haushalts- und Wirtschaftsführung der „Export-Akademie“ der Hochschule Karlsruhe geprüft und dabei festgestellt, dass jedenfalls im Haushaltsjahr 2006 die Einnahmen der Export-Akademie deren ausgewiesene Kosten im Wesentlichen gedeckt haben. Nach den Berechnungen des Rechnungshofs entstand dabei ein kleines Defizit in Höhe von 7.000 €.
Ursache für die günstigere Wirtschaftslage der Export-Akademie Karlsruhe gegenüber der Reutlinger Einrichtung ist neben einem marktgerechten Angebotsspektrum im Wesentlichen der weitgehende Verzicht auf festes Personal und die strikte Vorgabe der Hochschulleitung, dass nur Veranstaltungen stattfinden dürfen, deren Einnahmen die Vollkosten der Veranstaltung decken.
5.2 Fehlerhafte Anwendung des Nebentätigkeitsrechts
Allerdings hat die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Karlsruher Export-Akademie gezeigt, dass das Nebentätigkeitsrecht nicht immer beachtet wurde.
Bei der Vergütung der von den Professoren der eigenen und einer benachbarten Hochschule als Seminarleiter geleisteten Nebentätigkeiten wurde nicht ausreichend zwischen den nebentätigkeitsrechtlich privilegierten Lehrtätigkeiten und der nicht privilegierten Seminarorganisation differenziert. Dadurch ergaben sich bei einzelnen Professoren Gesamtvergütungen in einer Höhe, die eine Ablieferungspflicht begründen. Die Hochschulen werden zu prüfen haben, in welchem Umfang diese Ablieferungspflichten für die Vergangenheit noch rechtlich durchsetzbar sind. Für die Zukunft ist den Hochschulen und ihren Professoren zu empfehlen, sorgfältiger zwischen privilegierten und nicht privilegierten Nebentätigkeiten zu differenzieren.
Bei einem seit mehreren Jahren im Rahmen der Export-Akademie tätigen Professor lag die erforderliche Nebentätigkeitsgenehmigung seiner Hochschule nicht vor.
6 Stellungnahme der Hochschulen und des Ministeriums
Die Hochschule Reutlingen macht geltend, das Defizit des Jahres 2006 belaufe sich, wenn man offene Verbindlichkeiten, Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtige, auf nur 108.000 €. Der Prognose des Rechnungshofs, dass auch künftig mit jährlichen Defiziten in einer Größenordnung von 100.000 € zu rechnen sei, werde allerdings nicht widersprochen.
Entgegen der Behauptung des Rechnungshofs stelle die Hochschule Reutlingen der Exportakademie jährlich alle gewährten Leistungen vollständig in Rechnung.
Die Vorschläge des Rechnungshofs zur Neuausrichtung der Exportakademie würden von den zuständigen Hochschulorganen geprüft: Sollte sich weder eine Angliederung an eine bestehende Einrichtung noch eine Privatisierung realisieren lassen, so werde das Präsidium der Hochschule im Einvernehmen mit dem Wissenschaftsministerium die erforderlichen Maßnahmen für eine Schließung der Einrichtung in die Wege leiten.
Die Hochschule Karlsruhe macht geltend, dass namensrechtliche Probleme beim Betrieb der Export-Akademie nicht gesehen werden, die Hochschule Reutlingen habe die Verwendung des Namens vielmehr immer geduldet.
Die Auffassung des Rechnungshofs, dass Teile der Vergütungen für die Seminarleiter ablieferungspflichtig seien, werde nicht geteilt, da die Seminarleitung insgesamt zu den privilegierten Nebentätigkeiten gehöre, für die keine Ablieferungspflicht bestehe. Mindestens sei der Anteil der reinen Lehr- und Vortragstätigkeit an den Aufgaben eines Seminarleiters so hoch, dass im Ergebnis die Betragsgrenzen der Nebentätigkeitsverordnung in keinem Fall überschritten worden seien.
Das Wissenschaftsministerium schließt sich der Empfehlung des Rechnungshofs zur Schließung der Exportakademie Reutlingen an und hat die Hochschule Reutlingen aufgefordert, bis zum Juli 2008 ein Konzept zum Abbau des an der Exportakademie beschäftigten Personals vorzulegen.
7 Schlussbemerkung
Der Rechnungshof bleibt bei seiner Auffassung.
Was wurde aus dem Beitrag?
Die parlamentarische Behandlung finden Sie hier
Anhänge
Der Rechnungshof berichtet in diesem Abschnitt der Denkschrift über Auswirkungen der Tätigkeit der Finanzkontrolle. Der Bericht gibt die Umsetzung einiger bedeutsamer Vorschläge aus früheren Denkschriftbeiträgen, aus der Beratenden Äußerung zur Landesoberkasse Baden-Württemberg sowie aus beratungsorientierten Prüfungen wieder. Er stellt - soweit dies möglich ist - die finanziellen Auswirkungen dar.
Die Information soll dem Parlament, zeitgleich mit der Vorstellung der Denkschrift, einen Überblick über wesentliche Ergebnisse aus früheren Prüfungen und über die Umsetzung seiner Beschlüsse vermitteln.
Die nachstehende Darstellung ist nicht Gegenstand des laufenden Verfahrens zur Entlastung der Landesregierung im Sinne von § 97 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung.
[Der gesamte Text einschließlich Einzelergebnisse ist in der nachfolgenden PDF-Datei enthalten]
Anhänge
Erstmals in seiner Geschichte wird der Rechnungshof im Herbst 2008 einen Ergebnisbericht auflegen. Mit diesem Bericht sollen künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus sämtliche parlamentarisch abschließend behandelten Prüfungen vorgestellt werden. Berichtet wird über die Zeit vom Januar 2006 bis Juni 2008. Die Denkschrift kann im Blick darauf ohne das bisher übliche Kapitel „Auswirkungen der Prüfungstätigkeit“ erscheinen
